Argumente pro und contra Speziesismus
Seit den 1970er Jahren dominiert der Ausdruck "Speziesismus" die tierethische Debatte. Doch was steckt eigentlich dahinter und welche Gründe für und wider eine ungleiche Behandlung von Lebewesen aufgrund ihrer Spezieszugehörigkeit gibt es? Martin Pätzold hat für tier-im-fokus.ch (tif) die wichtigsten Argumente zusammengestellt.
Archiv
Dies ist ein Beitrag von unserer alten Website. Es ist möglich, dass Bilder und Texte nicht korrekt angezeigt werden.
- Einleitung
- Teil 1: Allgemeine Argumente
- Ungleiche Behandlung: normal, natürlich und notwendig
- Konfliktfälle, Erzeugung und Religion
- Teil 2: Spezifische Argumente
- Leidensfähigkeit, Intelligenz und Lebensqualität
- Reflexionsvermögen, Sprache und Rationalität
- Selbstbewusstsein und Zukunftsbewusstsein
- Soziale Beziehungen und Autonomie
- Reziprozität, Vertragstheorie und moralisches Handeln
- Teil 3: Speziesismus und menschliche Grenzfälle
- Potenzialität, „normale“ Menschen und menschliche Verwandtschaft
- Menschenwürde, schiefe Ebene und instabile Gesellschaft
- Nachbemerkungen
- Fussnoten
- Literatur
- Weitere tif-Materialien zum Thema
Einleitung
Speziesismus ist eine Einstellung, die in unserer Gesellschaft seit langer Zeit besteht und im Denken fest verankert ist. Die Gegner des Speziesismus – die Antispeziesisten – sagen, er sei nicht gerechtfertigt. Weil das Gleichheitsprinzip – also gleiche Fälle gleich zu behandeln, oder kurz gesagt: fair zu sein – eine Grundlage der Ethik ist, gebe es keine Rechtfertigung, nichtmenschliche Tiere grundsätzlich anders zu behandeln, als wir in vergleichbaren Fällen Menschen behandeln würden. Der Umgang der Speziesisten mit Tieren sei diskriminierend: Er begründet die Ungleichbehandlung mit Argumenten, die nicht zutreffen und/oder ethisch irrelevant sind.
Um falschen Schlussfolgerungen zuvor zu kommen, sei erwähnt, was Antispeziesisten unter „gleiche Behandlung in vergleichbaren Fällen“ meinen, woraus sie ihre Forderung nach Tierrechten ableiten. Sie meinen damit keine Gleichmacherei. Weder sollen Kühe ein Bildungsrecht, noch Schweine ein Recht auf Kunstfreiheit oder Hühner ein Wahlrecht erhalten. Das wären keine vergleichbaren Fälle, da Kühe kein Interesse an Bildung, Schweine keines an Kunst und Hühner keines an Politik haben.
Um vergleichbare Fälle handelt es sich jedoch, wenn diese Tiere ausgenutzt und getötet werden, da sie ein Interesse an körperlicher Unversehrtheit und am Weiterleben haben. [1] Die Forderungen nach Gleichberechtigung und Tierrechten beziehen sich auf diese Bereiche.
Man kann dies am Beispiel der Menschenrechte veranschaulichen. Nicht alle Menschen haben genau die gleichen Rechte. Kleinkinder haben kein Wahlrecht und geistig schwer behinderte Menschen kein Recht auf höhere Bildung (bzw. können sie es nicht erwerben). Trotzdem sprechen wir hier nicht von Ungleichbehandlung oder Diskriminierung, weil diese Menschen an diesen Bereichen keine Interessen haben bzw. haben können. Und doch haben alle, auch diese Menschen, die gleichen Grundrechte. Man darf sie nicht ausnutzen, ihnen keinen Schaden zufügen oder sie töten. [2] Sie haben das Grundrecht auf körperliche und geistige Unversehrtheit und das Grundrecht auf Leben. [3]
Speziesisten sind der Ansicht, diese Gleichberechtigung von nichtmenschlichen Tieren und Menschen sei nicht gerechtfertigt. Dafür können allgemeine Gründe angeführt werden. Um sie wird es im ersten Teil gehen.
Es können bestimmte Eigenschaften oder Fähigkeiten, die den Menschen einmalig machen, betont werden. Weil der Mensch diese besitzt, die anderen Tiere jedoch nicht – so die Argumentation –, sei die Ungleichbehandlung gerechtfertigt. Darum wird es im zweiten Teil gehen.
Schließlich wird infrage gestellt, ob die Analogie mit Kleinkindern und geistig behinderten oder erkrankten Menschen (den sogenannten „menschlichen Grenzfällen“) berechtigt ist, die oft benutzt wird, um zu zeigen, dass Argumente gegen Tierrechte unplausibel sind. Denn auch wenn diese menschlichen Grenzfälle bestimmte Eigenschaften und Fähigkeiten nicht besitzen, manche nichtmenschlichen Tiere sie jedoch aufweisen, gebe es dennoch Gründe, Menschen anders zu behandeln. [4] Diese Argumente werden im dritten Teil behandelt. [5]
Teil 1: Allgemeine Argumente
Speziesismus ist nicht gleich Speziesismus. Unter verschiedenen Unterscheidungen, die möglich sind, ist die von Rachels eingeführte Unterscheidung zwischen unqualifiziertem und qualifiziertem Speziesismus eine der grundlegenden (vgl. Rachels 1990, 182-184). Der unqualifizierte Speziesismus sieht bereits die nur Spezieszugehörigkeit als ethisch relevant an, der qualifizierte sieht nicht die Spezieszugehörigkeit allein als ethisch relevant an, sondern eine bestimmte Eigenschaft oder Fähigkeit (die jedoch mit der Spezieszugehörigkeit verknüpft ist).
Die Argumente im ersten Teil beruhen vordergründig auf unqualifiziertem Speziesismus: Die Spezieszugehörigkeit allein, zusammen mit den jeweiligen Behauptungen, reicht aus, um die Ungleichbehandlung zu rechtfertigen. Die Argumente stammen aus sehr verschiedenen Bereichen, sind aber bereits beim zweiten Blick fragwürdig.
Normal, natürlich und notwendig
Die Ungleichbehandlung von Mensch und Tier hat eine lange Tradition, sie ist gesellschaftlich normal und deshalb gerechtfertigt!
Erwiderung: Auch Menschensklaverei hat eine Jahrtausende alte Tradition, während die Verbote der Sklaverei (in der westlichen Welt) nur ca. zweihundert Jahre alt sind. Diese Verbote wurden ebenfalls zu einer Zeit erlassen, als Sklaverei gesellschaftlich weitgehend normal war. Tradition oder gesellschaftliche Normalität sind daher keine überzeugenden Rechtfertigungen.
Tiere töten andere Tiere, das ist natürlich. Daher muss dies auch dem Menschen erlaubt sein!
Erwiderung: Genau genommen tun das nur die wenigsten, nämlich die fleischessenden Tiere. Den größeren Teil der Arten und Populationen stellen jedoch die Pflanzenesser. Mit welcher Begründung sollte man sich die einen und nicht die anderen zum Vorbild nehmen?
Die eigentlichen Punkte, die gegen dieses Argument sprechen, sind jedoch die folgenden: Zum einen haben nichtmenschliche Tiere kaum eine Möglichkeit, ihre Nahrung zu wählen, Menschen hingegen haben die Wahl. Deshalb dürfen sie kritisiert werden, wenn sie die schlechtere von zwei Alternativen wählen, d.h. Tiere töten, obwohl dies nicht notwendig ist.
Zum anderen müsste man konsequent sein, wenn man sich die Natur als Vorbild für die menschliche Ethik aussucht. In der Natur ist auch die Tötung von Neugeborenen durch Angehörige der gleichen Art (Infantizid) verbreitet, meist in Verbindung mit Kannibalismus. Falls man das Töten von Tieren durch andere Tiere als Begründung nimmt, müsste auch dieses Verhalten gesellschaftlich erlaubt sein. Diese Konsequenz zieht jedoch niemand.
In der Natur gilt das Recht des Stärkeren!
Erwiderung: Diese Begründung ist einerseits falsch, da viele Tierarten ebenfalls altruistisches Verhalten kennen wie etwa die Versorgung von altersschwachen Tieren oder die Adoption von Waisen.
Andererseits akzeptieren wir dieses Argument aus guten Gründen nicht (mehr) in Bezug auf Menschen. Auch „schwache“, schutzlose Menschen wie Behinderte haben (inzwischen) die gleichen Grundrechte wie alle anderen. Wenn wir dieses Argument in Bezug auf Menschen nicht akzeptieren, gibt es auch keinen Grund, es in Bezug auf andere Tiere zu tun.
Ohne Tiernutzung in der Vergangenheit hätten wir nicht die Gesellschaft, wie wir sie heute kennen. Die Ungleichbehandlung von Mensch und Tier war also notwendig und ist deshalb gerechtfertigt!
Erwiderung: Die Gesellschaft, insbesondere der westliche Lebensstandard, würde ohne die Menschensklaverei ebenfalls nicht existieren. Sie verhalf den antiken Hochkulturen zur Blüte, auf deren Errungenschaften wir bis heute zurückgreifen, und sie war ein Grundstein für die wirtschaftliche Entwicklung in der Neuzeit, die zur Industrialisierung führte. Da dieses Argument nicht (mehr) akzeptiert wird, um Menschensklaverei zu legitimieren, ist es auch nicht geeignet, um die Versklavung anderer Tieren zu rechtfertigen.
Ohne Ungleichbehandlung von Mensch und Tier könnten wir keine Tierprodukte konsumieren und auch keine Medikamente entwickeln, sie ist also unerlässlich und daher gerechtfertigt!
Erwiderung: Das Konsumieren von Tierprodukten ist nicht notwendig. Eine ausgewogene vegane Ernährung ist empirisch und wissenschaftlich nachweislich für jedes Lebensalter und für jede Beanspruchung (inklusive Hochleistungssport) geeignet.
Auch Tierversuche sind zur Entwicklung und Produktion von Medikamenten nicht notwendig. Es gibt viele Alternativverfahren, deren Potenziale bisher nicht ausgeschöpft wurden. Dagegen sind Tierversuche oftmals hinderlich, weil sie falsche, fehlerhafte und nicht verwertbare Ergebnisse liefern. Auch jene Tierversuche, die als nützlich gelten könnten, lassen sich hiermit nicht rechtfertigen. Schließlich wären auch (vergleichbare) Versuche an Menschen zur Entwicklung von Medikamenten nützlich und sinnvoll, dennoch sind Experimente an Menschen (früher meist Behinderte, Waisen, Häftlinge oder Minderheiten) inzwischen aus ethischen Gründen verboten.
Konfliktfälle, Erzeugung und Religion
Wenn Menschen in einem Konfliktfall die Wahl treffen müssten, einen Menschen oder ein Tier zu retten, würden sie sich immer für den Menschen entscheiden. Daher darf man Menschen grundsätzlich anders behandeln als Tiere!
Erwiderung: Wie Gary L. Francione anmerkt, ist es fraglich, ob Menschen immer so handeln würden (vgl. Francione 2000, 151-154). Falls der Mensch ein Verbrecher oder auch einfach ein Fremder ist, das nichtmenschliche Tier dagegen das sogenannte Haustier des Betroffenen, würden die meisten eher das nichtmenschliche Tier retten.
Der eigentliche Punkt, der gegen dieses Argument spricht, ist jedoch, dass man von Konfliktsituationen nicht verallgemeinern kann. Das zeigt sich auch dann, wenn die Entscheidung zwischen zwei Menschen getroffen werden müsste. Alle Menschen würden bei der Wahl zwischen z.B. dem eigenen und einem fremden Kind das eigene wählen. Daraus folgt jedoch nicht, dass man fremde Kinder in Nicht-Konfliktsituationen generell anders behandeln darf.
Dementsprechend folgt aus dem Umstand, dass man in einer Konfliktsituation eher einen Menschen als ein nichtmenschliches Tier retten würde, keineswegs, dass es generell erlaubt ist, nichtmenschliche Tiere auszubeuten, denn die Tierausbeutung ist kein Konfliktfall, da sie vermeidbar ist (siehe die vorhergehende Erwiderung).
Menschen haben Tiere erzeugt (gezüchtet). Daher haben sie auch ein Recht darüber zu bestimmen, wie sie sie behandeln!
Erwiderung: Dass Menschen Tiere erzeugt haben, gilt nur bedingt. Nahezu alle freilebenden Tiere, die ausgebeutet und getötet werden, wurden nicht von Menschen erzeugt. Das betrifft bei den Landtieren nur einen kleinen, bei den Meerestieren jedoch den größten Teil. Vor allem aber folgt aus dem einen nicht das andere. Auch Eltern haben ihre Kinder erzeugt, dennoch gibt dies ihnen nicht das Recht, sie wie ihr Eigentum zu behandeln (und z.B. für Experimente zu verkaufen). Eltern haben zwar ein gewisses Bestimmungsrecht über ihre Kinder, doch dürfen sie deren Grundrechte nicht verletzen.
Ähnliches gilt für viele Sklavenhaltergesellschaften. Dort wurden nicht nur Zivilisten oder Kriegsgefangene versklavt, sondern auch bereits gefangene Sklaven zur „Reproduktion“ gezwungen, weil dies die billigste Methode war, neue Sklaven zu beschaffen. Auch hier würde niemand behaupten, diese Menschen zu versklaven sei gerechtfertigt, weil die Sklavenhalter sie (direkt oder indirekt) erzeugt haben.
Rechte sind eine menschliche Erfindung, sie werden von Menschen gemacht und gelten nur für Menschen.
Erwiderung: Dieses Argument wird mit einem Blick in die Geschichte hinfällig. Die Rechte, die Weiße gemacht hatten und nur für Weiße galten, konnten auch auf Menschen anderer Hautfarbe erweitert werden. Die Rechte, die Männer gemacht hatten und nur für Männer galten, konnten auf Frauen ausgedehnt werden. Auch die Rechte, die geistig gesunde Menschen gemacht hatten und nur für sie galten, konnten auf geistig behinderte Menschen ausgeweitet werden (obwohl manche dieser Behinderten diese Rechte nicht verstehen oder gegenüber anderen einhalten konnten). Daher gibt es keinen Grund, menschliche Grundrechte nicht auch auf nichtmenschliche Tiere auszuweiten.
Gott hat die Herrschaft über die Tiere legitimiert und nur Rechte für Menschen geboten! Außerdem haben Tiere keine Seele!
Erwiderung: Dieses Argument ist nur für Gläubige gültig. Auf den großen und stetig wachsenden Anteil der Atheisten in den modernen Gesellschaften ist es hingegen nicht anwendbar.
Dazu kommt, dass Menschenrechte aus den einschlägigen religiösen Texten (was unseren Kulturkreis betrifft: der Bibel) nicht abgeleitet werden können. Dort ist nirgendwo von Menschenrechten die Rede, stattdessen gibt es eine Vielzahl an Stellen, in denen die Sklaverei gerechtfertigt wird. Die Idee der universalen Menschenrechte ist hingegen eine Errungenschaft der säkularen Aufklärung.
Was die Seele betrifft: Wenn sie als etwas verstanden wird, das nach dem Tod weiterlebt, hilft dieses Argument nicht um zu begründen, weshalb man die Lebewesen mit und jene ohne Seele während des Lebens unterschiedlich behandeln darf. Wenn es für Menschen ein Leben nach dem Tod gäbe und für andere Tiere nicht, würde das vielmehr dafür sprechen, gerade Tiere gut zu behandeln, da sie den „Trost des ewigen Lebens“ nicht haben. Generell müsste für diese Argumentation die Existenz von Gott oder der Seele jedoch erst bewiesen werden. Die Erkenntnisse der Wissenschaft besagen allerdings das Gegenteil.
Religionen wie der Buddhismus lehren, dass die Reinkarnation von Menschen in Tieren als Strafe wegen schlechten Karmas erfolgt. Das zeigt die geringere Wertigkeit der Tiere gegenüber Menschen und deshalb ist die Ungleichbehandlung gerechtfertigt!
Erwiderung: Auch dieses Argument ist nur für Gläubige, nicht aber für Atheisten gültig, zumal die Existenz von Reinkarnation ebenfalls unbewiesen und wissenschaftlich betrachtet äußerst unwahrscheinlich ist.
Teil 2: Spezifische Argumente
Die bisher betrachteten Gründe für den Speziesismus sind die populären Argumente. Sie sind weit verbreitet, doch sind es schwache Argumente. Es kann einfach gezeigt werden, dass sie logisch nicht konsistent sind, in vergleichbaren Fällen nicht gelten und/oder die dahinter stehende Voraussetzung nicht existiert.
Auf qualifiziertem Speziesismus (zum Begriff s.o.) beruhen hingegen die folgenden Argumente, die eine Eigenschaft oder Fähigkeit hervorheben, welche (angeblich) nur bei Menschen existiert. Diese Differenz soll Menschen von allen nichtmenschlichen Tieren unterscheiden. Weil nichtmenschliche Tiere mindestens eine der im Nachfolgenden diskutierten Eigenschaften oder Fähigkeiten nicht besitzen, kämen ihnen keine Grundrechte zu.
Zwischenbemerkung zum Verhältnis kognitiver Eigenschaften oder Fähigkeiten und ethischer Berücksichtigung: Die Bezugnahme auf die kognitiven Leistungen von nichtmenschlichen Tieren vonseiten der Speziesisten, wie es bei den nachfolgenden Argumenten meist der Fall ist (z.B.: sie hätten kein Zukunftsbewusstsein), ist bereits grundsätzlich fraglich. Denn die ethischen Implikationen der Ethnologie und Kognitionswissenschaft sind umstritten (vgl. Perler/Wild 2005, 19-21). Man muss zwei Fragen unterscheiden: Welche Tiere haben welche kognitiven Fähigkeiten und zu welchem Grad? Und: Was folgt daraus für ihre ethische Berücksichtigung? Fast immer folgt daraus mit Bezug auf Grundrechte nämlich nichts. Zwar ist eine Form eines (basalen) Bewusstseins, worin die Empfindungsfähigkeit begründet ist, eine Voraussetzung für die ethische Berücksichtigung (weshalb z.B. Pflanzen oder Steine, sowie biologisch als Tiere geltende Einzeller wie Amöben ausgeschlossen sind), aber darüber hinaus wird betont, dass man aus dem Besitz oder Nicht-Besitz bestimmter kognitiven Eigenschaften oder Fähigkeiten nicht ohne weiteres auf die ethischen Implikationen schließen kann. Für weiterführende Rechte mag das anders aussehen – weniger intelligente Menschen können z.B. von höherer Bildung ausgeschlossen werden, genauso wie andere Tiere kein Recht auf höhere Bildung benötigen –, nicht aber für Grundrechte.
Zwischenbemerkung zum Rechtsbegriff: Mit „Rechten“ sind den menschlichen Grundrechten vergleichbaren Rechte gemeint wie das Recht auf körperliche Unversehrtheit und das Recht auf Leben. Es ist ein fehlerhafter Gebrauch des Rechtsbegriffs, zu sagen, Tiere hätten zwar kein Recht auf Leben, aber das „Recht“, in einem Großkäfig statt in vielen Kleinkäfigen gehalten zu werden (z.B. in sogenannter Freilandhaltung statt in Käfighaltung), oder das „Recht“ auf (vermeintlich) schmerzlose Tötung. Weiterführende Rechte zuzusprechen, aber Grundrechte zu verweigern, ist abwegig. (Zu dieser verbreiteten aber fehlerhaften Verwendungsweise des Rechtsbegriffs siehe auch Francione 1996, 139-141.)
Neben der Unterscheidung zwischen unqualifiziertem und qualifiziertem Speziesismus (s.o.), sei auch auf die Unterscheidung zwischen ‚altem‘ und ’neuem‘ Speziesismus (vgl. Dunayer 2004, 9ff., 77ff.) hingewiesen. Der Altspeziesismus hält an der traditionellen Dichotomie zwischen Menschen und anderen Tieren fest: Alle nichtmenschlichen Tiere haben keine Rechte. Der Neuspeziesismus gewährt einigen nichtmenschlichen Tiere Grundrechte. Das Kriterium ist die biologische Komplexität: privilegiert werden „hochentwickelte“ Tiere wie Menschenaffen und Delfine. [6] Beim Antispeziesismus werden dagegen alle empfindungsfähigen Spezies eingeschlossen. [7]
Die Argumentation für den Speziesismus muss zwei Voraussetzungen erfüllen, damit gezeigt werden kann, dass die entsprechende Eigenschaft oder Fähigkeit als hinreichende Begründung für die Ungleichbehandlung gelten kann (vgl. Pluhar 1995, 139; Ach 1999, 117f.):
(a) dass diese Eigenschaft oder Fähigkeit allen und nur Menschen zukommt, bei anderen Tieren also nicht vorhanden ist; und
(b) dass diese Eigenschaft oder Fähigkeit ethisch relevant ist, also im derzeitigen Umgang der Menschen untereinander von Bedeutung ist oder sein könnte. [8]
Leidensfähigkeit, Intelligenz und Lebensqualität
Nur Menschen können Schmerz empfinden, denn nur sie können uns das durch Sprache mitteilen. Ob andere Tiere ebenfalls Schmerz empfinden, selbst wenn ihr Verhalten ähnlich dem menschlichen Verhalten bei Schmerzempfindung ist, lässt sich nicht beweisen!
Erwiderung: Gegen diese Begründung sprechen das Analogie- und das Evolutionsargument. Das Analogieargument besagt (vgl. Wild 2008, 141f.): Viele nichtmenschliche Tiere haben Schmerzrezeptoren (Nozizeptoren), die mit einem Zentralnervensystem verbunden sind und bei Reizung entsprechende Signale abgeben. Man kann ihre Schmerzen durch schmerzstillende Mittel lindern, ihr Körper produziert körpereigene Stoffe zur Schmerzlinderung (endogene Opioide) und Verletzungen lösen das Verhalten aus, sich dem Schmerzreiz zu entziehen. Da andere Tiere diese Merkmale mit Menschen gemeinsam haben, ist es höchst unwahrscheinlich, dass die Schmerzempfindungen nicht ähnlich sind.
Das Evolutionsargument besagt: Schmerzempfindung hat die biologische Funktion, Schaden zu vermeiden und damit die Überlebenschancen zu erhöhen. Dieser Zweck wird bei nichtmenschlichen Tieren auf die gleiche Weise wie bei Menschen erfüllt. Er ist evolutionär sinnvoll; und da Menschen mit anderen Tieren eine gemeinsame evolutionäre Vergangenheit teilen, macht dies die gleiche Funktionsweise der Schmerzwahrnehmung plausibel. Die Argumentationsvariante, dass Tiere Schmerzen spüren könnten, aber nicht bewusst wahrnehmen, ist auch dem gleichen Grund unwahrscheinlich: würden sie ihn nicht wahrnehmen, könnte er die biologische Funktion nicht erfüllen. (Zu einer intensiveren Auseinandersetzung mit Behauptungen, Tiere könnten nicht leiden, siehe Pluhar 1995, 17-46, und DeGrazia 1996, 105-115.)
Darüber hinaus kommt die Fähigkeit zur Schmerzempfindung nicht allen Menschen zu (vgl. Dunayer 2004, 127). So haben Menschen mit angeborener Analgesie (Schmerzunempfindlichkeit) kein Schmerzempfinden. Dennoch besitzen sie die gleichen Grundrechte wie alle anderen Menschen. Leidensfähigkeit ist ethisch gesehen also nur beschränkt relevant.
Tiere sind weniger intelligent als Menschen, daher dürfen sie auch anders behandelt werden!
Erwiderung: Menschen sind nur dann im Durchschnitt die intelligentesten Tiere, wenn die menschliche Intelligenz als Maßstab angesetzt wird. Dafür gibt es keinen plausiblen Grund (siehe auch die Nachbemerkungen).
Vor allem aber fehlt die ethische Relevanz dieses Arguments. Menschen, die intelligenter sind als andere, haben deshalb nicht mehr Grundrechte. Joan Dunayer (vgl. Dunayer 2004, 26) illustriert diese Irrelevanz am Beispiel eines geistig schwer behinderten Menschen mit einem Intelligenzquotienten von 9 Punkten, dem durch den obersten Gerichtshof der USA volle Grundrechte zugesichert wurden. Ein Gorilla, dessen Intelligenzquotient auf 90 Punkte geschätzt wurde, hatte hingegen keinerlei Rechte. Demnach ist die Intelligenz für Grundrechte ethisch nicht relevant.
Aufgrund ihrer geringeren Intelligenz können sich Tiere nicht an so vielen Aspekten des Lebens erfreuen wie Menschen. Ihr Leben ist daher weniger wertvoll! Zudem leiden weniger intelligente Lebewesen in vergleichbaren Situationen weniger als intelligentere Lebewesen!
Erwiderung: Weil das vorhergehende Argument der geringeren Intelligenz keine ethische Relevanz besitzt, wird es oftmals durch dieses erweitert. Allerdings ist fraglich,
(1) dass höhere Intelligenz mit mehr positiven Empfindungen einhergeht;
(2) dass geringere Intelligenz mit weniger negativen Empfindungen (Leiden) einhergeht;
(3) dass das Leben von Menschen grundsätzlich eine höhere Qualität hat als das von anderen Tieren und dass dieser Umstand ethisch relevant ist.
Zu (1): Tiere haben oft stärker ausgeprägte Sinnesorgane (sie können z.B. besser riechen oder besser hören) und spezielle Fähigkeiten (sie können z.B. ohne Hilfsmittel fliegen und unter Wasser schwimmen). Dadurch besitzen sie eine höhere Qualität der Empfindungen in diesen Bereichen. Das eröffnet ihnen Wahrnehmungsgebiete und Möglichkeiten positiver Empfindungen, die Menschen nicht haben. Die Qualität des Lebens ist für nichtmenschliche Tiere eine andere als für Menschen, aber deshalb nicht grundsätzlich eine geringere.
Man könnte einwenden, Menschen seien aber in der Lage, intelligentere Tätigkeiten ausführen. Intelligentere Tätigkeiten versprechen jedoch nicht grundsätzlich mehr positive Empfindungen als weniger intelligente Tätigkeiten. Ob jemand ein Schachspiel oder das Anschauen einer Sportsendung stärker genießt, ist individuell unterschiedlich. Durch die evolutionäre Prägung ist es zudem so, dass bei Menschen wie bei anderen Tieren gerade die einfachen Tätigkeiten wie Essen und sexuelle Handlungen stimulierender sind als komplexe kognitive Tätigkeiten.
Zu (2): Ein geringeres Verständnis für eine Situation kann dazu beitragen, dass das psychische Leiden größer, nicht kleiner ist. Menschen können Trost aus dem Wissen schöpfen, dass eine negative Situation in absehbarer Zeit vorbei sein wird (ob bei schmerzhafter ärztlicher Behandlung oder in vorübergehender Gefangenschaft). Andere Tiere haben diesen Trost nicht, da ihnen meist das Verständnis der Situation fehlt, leiden also mehr.
Zu (3): Auch mit der Erweiterung des Arguments der geringeren Intelligenz fehlt nach wie vor die ethische Relevanz. Beim Beispiel, das in der vorhergehenden Erwiderung genannt wurde, hätte nach dieser Annahme der Mensch mit einem Intelligenzquotienten von 9 Punkten eine geringere Qualität des Lebens als viele nichtmenschliche Tiere. Affen oder Papageien, deren Intelligenz mit derjenigen von drei- bis fünfjährigen Kindern verglichen wird, hätten eine höhere Qualität des Lebens als ein- bis zweijährige Kinder. Dennoch haben zweijährige menschliche Kinder Grundrechte, die andere Tiere, obwohl sie intelligenter sind, nicht haben.
Reflexionsvermögen, Sprache und Rationalität
Tiere können nicht wie Menschen reflektieren. Daher dürfen sie auch ungleich behandelt werden!
Erwiderung: Mit der Behauptung, nichtmenschlichen Tiere fehle das Reflektionsvermögen, kann gemeint sein, dass sie ihre Stellung in der Welt nicht reflektieren können. Das ist jedoch fraglich. Viele Tiere haben Gedanken in Form von mentalen Repräsentationen, d.h. sie interpretieren Dinge in ihrer Umwelt und verhalten sich dementsprechend (vgl. Wild 2008, 106). Deshalb wird dieses Argument oft so erweitert, dass Tiere vielleicht Gedanken haben, aber nicht unbedingt denken können, d.h. sie sind nicht in der Lage, diese Gedanken zu reflektieren und sogenannte Metagedanken zu bilden. Um Metagedanken zu haben, müssten Tiere den Wahrheitswert des von ihnen Gedachten bestimmen können, d.h. eine Unterscheidung zwischen falsch und richtig treffen können. Dazu müssten sie ein Korrekturverhalten zeigen und z.B. eine als falsch erkannte Handlung berichtigen. Diese Fähigkeit besitzen einige Spezies, sie wurde unter anderem für Schweine nachgewiesen (vgl. Allan 2005, 198). Für Spezies, die für genauso oder intelligenter gelten, kann das ebenso angenommen werden.
Wiederum fehlt aber die ethische Relevanz dieses Arguments. Kleinkinder bis zu einem bestimmten Alter sowie geistig behinderte Menschen ab einer bestimmten Schwere der Behinderung können sich wahrscheinlich noch nicht bzw. nicht in der Welt verorten und auch keine Metagedanken bilden. Dennoch werden ihnen Grundrechte nicht abgesprochen oder vorenthalten. Das Reflexionsvermögen ist also kein ethisch relevantes Kriterium.
Tiere haben keine Sprachfähigkeit und daher keine Rationalität!
Erwiderung: An diesem Argument ist dreierlei fraglich:
(1) dass Tiere nicht sprachfähig sind, weil sie nicht sprechen (also sich artikulieren) können;
(2) dass aus einem Mangel an Sprachfähigkeit folgt, sie hätten keine Rationalität;
(3) dass diese Fähigkeit nur Menschen und keinen anderen Tieren zukommt sowie ethisch relevant ist.
Zu (1): Dass alle Tiere keine Sprache hätten, ist durch die Verhaltensforschung hinreichend widerlegt. Wie andere (nichtmenschliche) Affen können auch Schimpansen aus physiologischen Gründen keine differenzierteren Laute produzieren, aber einige haben Zeichensprache inklusive Syntax und einen Wortschatz von mehreren Tausend Wörtern erlernt. Das bedeutet zwar, dass Tiere nicht sprechen können – sie können keine komplexen Wörter artikulieren –, jedoch nicht, dass sie nicht sprachfähig sind.
Auch für andere Spezies wie etwa Graupapageien wurde die Fähigkeit zu komplexerer Sprache nachgewiesen und bei Meerkatzen der Besitz von abstrakten (also nicht nur konkreten) Begriffen (vgl. Allen & Saidel 2005). Die Anforderungen an sprachliche Äußerungen – sie sollten eine referenzielle, semantische, pragmatische und kommunikative Funktion aufweisen (so Perler & Wild 2005, 25) – können auch durch einfache Lautäußerungen oder Gesten erfüllt werden. Die evolutionäre Kontinuität, die Menschen mit anderen Tieren verbindet, macht es unwahrscheinlich, dass nur Menschen eine Sprache besitzen, da ihre biologische Nützlichkeit für die anderen Spezies gleichermaßen gilt (siehe analog den Punkt Leidensfähigkeit).
Zu (2): Das hängt wiederum davon ab, wie man Rationalität – also die Fähigkeit, denken zu können – definiert. Die Sprache ist dabei wichtig, weil behauptet wird, dass es nicht möglich sei, ohne Begriffe Gedanken zu formulieren. Das scheint auf den ersten Blick einleuchtend, so ist es schwer möglich, z.B. den Gedanken „Ich gehe morgen in die Stadt“ zu denken, ohne ihn in Begriffen zu formulieren. Dennoch ist es fraglich, dass Begriffe für die Bildung von Gedanken notwendig sind. So haben Kinder noch im Alter von fünf Jahren Erinnerungen an Ereignisse, die sie in ihrem ersten Lebensjahr erlebt haben (vgl. Tustin & Hayne 2010). Sie hatten also höchstwahrscheinlich bereits zu einer Zeit Gedanken, in der sie noch kein Sprachvermögen besaßen. (Zu Gedanken ohne Sprache siehe weiter bei u.a. DeGrazia 1996, 138-143, und Steiner 2008, Kap. 2.)
Auch für intentionale Zustände (z.B. die Wahr/Falsch-Unterscheidung), die nichtmenschlichen Tieren fehlen sollen, ist keine Sprache notwendig (vgl. Searle 2005). Verschiedene Forscher bestätigen daher, dass Sprachfähigkeit für den Besitz von Rationalität nicht notwendig ist (siehe die Übersicht bei Wild & Tietz 2006, 18-21). Für ein Denken ohne Begriffe gibt es unterschiedliche Erklärungsansätze wie etwa denjenigen der Mentalsprache (vgl. Wild 2008, 79-84, 120).
Zu (3): Kleinkinder bis zu einem gewissen Alter sowie geistig behinderte Menschen ab einer gewissen Schwere der Behinderung können kaum oder nicht sprechen oder Sprache verstehen. Letztere werden unter Umständen auch später nie eine Sprachfähigkeit entwickeln. Trotzdem sprechen wir ihnen keine Grundrechte ab. Die oben genannten Affen und Papageien, die zu komplexerer Sprache fähig sind als einige der menschlichen Grenzfälle, haben jedoch keinerlei Grundrechte. Sprachfähigkeit kann also nicht als ethisch relevantes Kriterium betrachtet werden.
Selbstbewusstsein und Zukunftsbewusstsein
Tiere haben kein Bewusstsein von sich selbst. Sie können sich nicht als Individuen wahrnehmen, d.h. von anderen Tieren unterscheiden. Und sie können dies deshalb nicht, weil sie sich nicht in der Zeit verorten können!
Erwiderung: Hier ist folgendes zu unterscheiden:
(1) ob Tiere kein Bewusstsein von sich selbst haben;
(2) ob Tiere kein Bewusstsein von sich als Individuen haben;
(3) ob für ein Bewusstsein von sich selbst eine Verortung in der Zeit notwendig ist;
(4) ob Selbstbewusstsein nur Menschen und keinen anderen Tieren zukommt und damit ethisch relevant ist.
Zu (1): Gemäss Ethologen wie Donald Griffin oder Bernard Rollin muss jedes Lebewesen, das ein wahrnehmendes (perzeptuelles) Bewusstsein besitzt, einen gewissen Grad an Selbstbewusstsein besitzen (vgl. Steiner 2008, Kap. 2). Wenn ein Tier Schmerz verspürt, muss es sich bewusst sein, dass es selbst es ist, das diesen Schmerz verspürt. Um diese Selbstzuschreibung vornehmen zu können, ist ein Bewusstsein von sich selbst notwendig. Ansonsten würde das bedeuten, Tiere spüren Schmerz ohne sich bewusst zu sein, dass es ihr Schmerz ist.
Zu (2): Wenn das Fluchtverhalten einer Herde ausgelöst wird, haben nur wenige Tiere die Gefahr konkret gesehen, alle anderen fliehen, weil sie es den anderen Artgenossen um sie herum gleichtun. Damit ein einzelnes Tier der Herde ebenso die Flucht ergreift wie alle anderen, muss es dieses Fluchtverhalten bei den anderen als Fluchtverhalten interpretieren können und es muss die anderen Tiere als andere (aber zur Herde gehörig) von sich selbst (als auch zur Herde gehörig) unterscheiden können. Daher erfordert bereits dieses einfache Verhalten, welches als rein instinktiv gilt („Herdentrieb“), eine Form von Bewusstsein von sich selbst als Individuum.
Zu (3): In Anlehnung an Damasio argumentiert Gary L. Francione dafür, dass auch ein autobiographischer Sinn (d.h. sich selbst in der Zeit verorten zu können) für Selbstbewusstsein nicht notwendig ist (vgl. Francione 2000, 139f.). Damasio unterscheidet zwischen erweitertem Bewusstsein und Kernbewusstsein. Das, was nach Damasio Kernbewusstsein genannt wird, informiert das Ich über seine Situation im Hier und Jetzt; das erweiterte Bewusstsein dagegen informiert über die Vergangenheit sowie die Pläne für die Zukunft. Zwar haben die meisten nichtmenschlichen Tiere im Gegensatz zu Menschen kein erweitertes Bewusstsein, jedoch gibt es auch Menschen, die z.B. in Folge eines Hirnschadens durch einen Unfall lediglich ein Kernbewusstsein besitzen. Trotzdem haben diese Menschen ein Selbstbewusstsein. Daher ist ein Kernbewusstsein für den Besitz von Selbstbewusstsein ausreichend und Kernbewusstsein besitzen laut Damasio auch die meisten empfindungsfähigen Tiere.
Zu (4): Auch Kleinkinder unter drei Jahren und geistig behinderte Menschen ab einer gewissen Schwere der Behinderung haben kein Bewusstsein von sich selbst als Individuum und können sich nicht in der Zeit verorten. Tiere, die ein erweitertes Bewusstsein besitzen, sind dagegen mit hoher Wahrscheinlichkeit dazu fähig. Dennoch werden diesen Menschen (z.B. Kindern unter drei Jahren) keine Grundrechte abgesprochen.
Weil der Mensch ein Bewusstsein von der Zukunft hat, hat er ein Interesse weiterzuleben. Tiere hingegen haben kein Zukunftsbewusstsein und daher keine Wünsche für die Zukunft und auch kein Interesse am Weiterleben. Deshalb fügt man ihnen keinen Schaden zu, wenn man sie tötet!
Erwiderung: An diesem Argument ist zweierlei fraglich:
(1) dass aus dem Fehlen eines Zukunftsbewusstsein folgt, Tiere hätten kein Interesse am Weiterleben;
(2) dass es nur Menschen und keinen anderen Tieren zukommt und somit ethisch relevant ist.
Zu (1): Ein Zukunftsbewusstsein ist nicht erforderlich, damit ein Tier ein Interesse am Weiterleben hat. Wie Gary L. Francione und David DeGrazia argumentieren, hat jedes Lebewesen, das empfindungsfähig ist, ein Interesse daran, Freude zu vermehren und Leid zu vermeiden. Wird es getötet, ist es nicht mehr in der Lage, Freude zu vermehren. Um diese Möglichkeit zu erhalten, muss es daher zwangsläufig ein (wenn auch nicht bewusst reflektiertes) Interesse am Erhalt dieses Zustandes und damit am Weiterleben haben (vgl. Francione 2000, 137-146, und 2008, 148-169; DeGrazia 1996, 236, und 2002, 60f.). [9]
Das spiegelt sich im Überlebensinstinkt. Tiere nehmen in manchen Situationen extreme Schmerzen in Kauf, nur um am Leben zu bleiben. Daher ist es fraglich, dass sie trotzdem kein Interesse am Weiterleben haben sollen. Das Weiterleben ist für sie eine notwendige Bedingung, dieses und andere Interessen zu erfüllen (vgl. Ach 1999, 191f.). Zwar ist es zutreffend, dass viele nichtmenschliche Tiere „nur“ einen Überlebensinstinkt haben und Menschen dagegen meist aktiv über ihr Leben reflektieren können. Doch ist dieser Unterschied nur graduell. Somit fehlt das Argument, das begründet, wieso man ein Überlebensinteresse missachten darf, nur weil es weniger ausgeprägt ist.
Zu (2): Bei mehreren Spezies ist nachgewiesen, dass sie gezielt und nicht lediglich einem instinktiven Trieb folgend für die Zukunft planen. Darunter sind neben den üblichen, als intelligent bekannten Säugetieren auch Nicht-Säugetiere wie Häher, die beim Verzehr versteckter Nahrungsreserven zukunftsbezogene Unterscheidungen bei der Art der Nahrung treffen (vgl. Wild 2007, 40-42). Und DeGrazia argumentiert, dass alle Tiere, die Angst bzw. Furcht empfinden können (und das betrifft praktisch alle empfindungsfähigen), notwendigerweise ein Bewusstsein von zumindest der näheren Zukunft haben müssen (vgl. DeGrazia 1996, 119). [10]
Dagegen gibt es Menschen, die definitiv kein Zukunftsbewusstsein und keine Wünsche für die Zukunft haben. Dazu gehören unter den menschlichen Grenzfällen z.B. Menschen, die an transienter globaler Amnesie leiden (vgl. Francione 2008, 148-169). Ihre Behaltensspanne neuer Informationen ist auf maximal zweieinhalb Minuten beschränkt, danach haben sie das zuvor Gedachte und damit auch für die Zukunft gemachte Wünsche oder Pläne wieder vergessen. Sie leben für die Dauer der amnestischen Episode, die bis zu 24 Stunden anhalten kann, in der Gegenwart. Dennoch haben an solchen Krankheiten leidende Menschen auch weiterhin das Grundrecht auf Leben, das nicht für die Dauer der amnestischen Episode erlischt. Nichtmenschliche Tiere mit Zukunftsbewusstsein wie die Häher, die wahrscheinlich den größten Teil ihres Lebens durchgängig zukunftsbewusst sind, haben es nicht.
Soziale Beziehungen und Autonomie
Menschen haben mehr soziale Beziehungen als Tiere. Der Verlust eines Menschen wiegt daher schwerer als der eines Tieres, weil mehr Individuen davon negativ betroffen sind!
Erwiderung: An diesem Argument ist zweierlei fraglich (vgl. Dunayer 2004, 84-86):
(1) dass soziale Beziehungen grundsätzlich etwas Positives sind und ihr Verlust daher immer negativ ist;
(2) dass Menschen grundsätzlich mehr soziale Beziehungen als andere Tiere haben und dies ethisch relevant ist.
Zu (1): Soziale Beziehungen sind nicht automatisch etwas Positives. Wahrscheinlich müssen sehr viele Menschen auch mit anderen, ihnen unangenehm Menschen zusammenleben oder -arbeiten, weil sie sich nicht alle Beziehungen aussuchen können (das gilt für u.a. Nachbarn, Familienmitglieder oder Berufskollegen). Würde eine dieser unangenehmen Personen sterben, wäre der Verlust dieser sozialen Beziehungen nicht grundsätzlich negativ.
Zu (2): Viele Spezies sind hochsozial, man denke an Herden-, Rudel- oder Schwarmspezies, aber auch an Spezies mit starken Familienbanden. Ihre Individuen wenden wesentlich mehr Zeit für soziale Kontakte auf und haben wesentlich mehr soziale Bindungen als viele Menschen. Dazu kommen wiederum die menschlichen Grenzfälle wie Menschen mit Autismus, die generell wenige Sozialkontakte haben können bzw. haben. Dennoch werden solchen Menschen keine Grundrechte verwehrt oder gegenüber stärker sozialen Personen benachteiligt.
Nur Menschen besitzen Autonomie!
Erwiderung: Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, was unter Autonomie verstanden werden kann (vgl. Ach 1999, 124-127).
(a) Wenn Autonomie als Fähigkeit verstanden wird, selbst ethische Entscheidungen zu treffen, dann siehe die Erwiderung zum Argument der Reziprozität.
(b) Wenn Autonomie als Fähigkeit verstanden wird, Pläne für die Zukunft zu machen, dann siehe die Erwiderung zum Argument des Zukunftsbewusstseins.
(c) Wenn Autonomie als Fähigkeit verstanden wird, Entscheidungen bewusst (reflektiert) und nicht nur instinktiv zu treffen, wird das Argument aus zwei bereits bekannten Gründen hinfällig: Erstens gibt es nichtmenschliche Tiere, die autonom sind, wie z.B. solche, die Fehlentscheidungen korrigieren (siehe die Erwiderung zum Argument der Reflexivität) oder solche, die für die Zukunft planen (siehe die Erwiderung zum Argument des Zukunftsbewusstseins). Und zweitens gibt es Menschen, die in diesem Sinne nicht autonom sind wie z.B. menschliche Neugeborene, die hinsichtlich der Fähigkeit, bewusste Entscheidungen zu treffen, sehr unautonom sind.
(d) Die Meinung, Menschen wertschätzen die Freiheit grundsätzlich, nichtmenschliche Tiere aber nur zur Erreichung bestimmter Ziele, ist wenig plausibel. Es lassen sich keine praktisch relevanten Umstände denken, in denen Menschen eine Form von Freiheit wünschen, ohne sie dann in irgendeiner Weise zu nutzen oder nutzen zu können. Und auch in diesem Fall würde die ethische Relevanz in Bezug auf Grundrechte fehlen.
Reziprozität, Vertragstheorie und moralisches Handeln
Die Ethik der Menschen kommt durch einen gegenseitigen Vertragsschluss zustande, wozu die Wechselseitigkeit (Reziprozität) der Teilnehmenden gehört: Nur wer Pflichten übernimmt, soll auch Rechte haben. Da Tieren die Fähigkeit fehlt, am Vertragsschluss teilzunehmen bzw. Pflichten wahrzunehmen, müssen sie auch nicht nach dem Gleichheitsprinzip berücksichtigt werden!
Erwiderung: An diesem Argument ist fraglich, ob in einer Vertragstheorie nur aktiv Teilnehmende eingeschlossen werden können. Menschliche Grenzfälle wie Kleinkinder oder geistig Behinderte nehmen weder aktiv am Vertragsschluss teil, noch nehmen sie ethische Pflichten wahr.
Die Ungleichheit zwischen den Rechten und den Pflichten ist bei Kindern auch gesetzlich verankert: Bis zu einem bestimmten Alter sind sie nicht oder nur vermindert straffähig (haben also keine bzw. kaum Pflichten), besitzen aber dennoch alle Grundrechte. Geistig schwer behinderten Menschen fehlt in ähnlicher Weise die Möglichkeit zur Teilnahme am Vertragsschluss wie auch überhaupt das Verständnis von ethischen Pflichten. Diese Menschen nehmen nicht am Vertragsschluss teil, haben kein Rechtsverständnis und können keine Pflichten wahrnehmen, trotzdem haben sie die gleichen Grundrechte wie erwachsene Menschen.
Daher müssen zwei Fragen auseinander gehalten werden (vgl. Rachels 1990, 191f.): Wer entscheidet über Rechte? Und: Wer ist von diesen Rechten betroffen? Die beiden Gruppen müssen nicht identisch sein. Bei der klassischen Vertragstheorie ist diese Unterscheidung daher die einzige Möglichkeit, menschliche Grenzfälle einzuschließen, da sie sonst (da sie nicht am Vertragsschluss teilzunehmen können), ausgeschlossen wären. Damit fehlt wiederum die Begründung, wieso man nichtmenschliche Tiere, die diesen Grenzfällen hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Fähigkeiten gleich oder sogar überlegen sind, ausschließen darf. Dementsprechend zeigt der Philosoph Mark Rowlands, dass die Vertragstheorie zum Einschluss nichtmenschlicher Tieren durchaus geeignet ist (vgl. Rowlands 1998, Kap. 6; 2002, Kap. 3).
Nur Menschen kennen Moral, unter Tieren gibt es sie nicht. Daher müssen Tiere nicht moralisch berücksichtigt werden!
Erwiderung: Ethologen wie Frans de Waal betonten im Gegenteil, dass die Evolution der Ursprung der Moralität ist und es aufgrund der Kontinuität der Evolution unwahrscheinlich ist, dass es keine andere Spezies gibt, die zu moralischem Verhalten fähig ist. Beobachtungen bei Affen bestätigen diese These (vgl. de Waal 2000; 2008).
Darüber hinaus ist dieses Argument eine Variante des vorhergehenden (Reziprozität): Da nichtmenschliche Tiere ohne Verständnis von Moral gegenüber Menschen keine ethischen Pflichten wahrnehmen können, sollen sie auch keine Rechte erhalten. Dazu siehe die dortige Erwiderung.
Teil 3: Speziesismus und menschliche Grenzfälle
Das Problem der Argumente pro Speziesismus besteht darin, dass es (a) keine Eigenschaft oder Fähigkeit gibt, die alle Menschen von allen nichtmenschlichen Tieren unterscheidet und die (b) zudem als ethisch relevant gelten kann.
Diese beiden Punkte einzeln zu belegen, ist nicht schwierig. Sie in Kombination zu belegen dagegen schon. Je größer die Eindeutigkeit auf der einen Seite ist, umso kleiner ist sie auf der anderen: So kommt die Fähigkeit, Differentialgleichungen zu lösen, zwar nur Menschen zu (erfüllt (a), doch ist sie ethisch völlig irrelevant (erfüllt (b) nicht). Umgekehrt könnten Eigenschaften wie Autonomie ethisch gesehen schon eher relevant sein (erfüllt (b), sie kommen aber nicht allen Menschen zu, vielen nichtmenschlichen Tieren hingegen schon (erfüllt (a) nicht).
Jene Verteidiger des Speziesismus, die mit einer bestimmten Eigenschaft oder Fähigkeit argumentieren (und das tun praktisch alle), aber nicht gewillt sind, die Konsequenz zu ziehen und den menschlichen Grenzfällen (Kleinkindern, geistig behinderten oder dementen Menschen) Grundrechte wie das Recht auf Leben abzusprechen (das tun nur wenige), haben soweit ein Problem. Sie benötigen Argumente, die einerseits diese Grenzfälle in die moralische Gemeinschaft einschließen, obwohl sie die relevante Eigenschaft oder Fähigkeit nicht besitzen, und die andererseits nichtmenschliche Tiere ausschließen, obwohl sie darüber verfügen.
Auch diese Argumente haben die beiden genannten Anforderungen (a) und (b) zu erfüllen. Da sie zwangsläufig abstrakter sind und bisweilen sehr ins Metaphysische gehen, müssen sie zudem zeigen, dass ihr logischer Aufbau plausibel ist. [11]
Potenzialität, „normale“ Menschen und menschliche Verwandtschaft
Auch wenn Kleinkinder bestimmte Eigenschaften und Fähigkeiten noch nicht aufweisen, werden sie es bei normaler Entwicklung in absehbarer Zeit tun. Im Gegensatz zu Tieren haben sie die Möglichkeit (Potenzialität), die Eigenschaften und Fähigkeiten zu erlangen. Tiere aber haben diese Potenzialität nicht!
Erwiderung: Dieses Argument eignet sich zum Einschluss von Kleinkindern, aber nicht von allen Grenzfällen. Menschen, die mit einer irreversiblen geistigen Behinderung geboren sind (z.B. mit Tay-Sachs-Syndrom oder Mikrozephalie), oder Menschen, die im Laufe ihres Lebens durch eine Krankheit (z.B. Demenz) oder einen Unfall irreversibel geschädigt wurden, können die betreffende Eigenschaft oder Fähigkeit (z.B. entsprechend hohe Intelligenz) nie oder nicht wieder besitzen.
Zudem ist es unplausibel, Rechte aufgrund von Potenzialen zu vergeben oder abzusprechen. Ein aussichtsreicher Kandidat für eine politische Position bekommt die Rechte, die dieses Amt mit sich bringt, erst dann, wenn er wirklich gewählt und im Amt eingesetzt wurde, und nicht bereits dann, wenn er aufgrund seiner Nominierung oder Umfragen das Potenzial hat, das Amt zu erlangen. Auf der anderen Seite werden Menschen mit (bisher) unheilbaren Krankheiten, an denen sie wahrscheinlich bald sterben werden, nicht aufgrund der Potenzialität zu sterben, wie Tote behandelt.
Menschlichen Grenzfällen fehlt zwar die jeweilige Eigenschaft oder Fähigkeit, aber die meisten anderen Menschen besitzen diese Eigenschaft oder Fähigkeit normalerweise. Daher sollte man sie so behandeln, wie man Menschen im Normalfall behandeln würde!
Erwiderung: Das Argument widerspricht der Natur von Rechten. Rechte werden an bestimmte Individuen entsprechend ihrer Interessen (die oft aus ihren Fähigkeiten und Eigenschaften resultieren) verliehen. Daher haben Personen mit einem gymnasialen Abschluss ein Recht auf universitäre Bildung, Personen ohne diesen Abschluss haben es nicht. Eine Person ohne gymnasialen Abschluss könnte ihre Zulassung zum Studium nicht damit einklagen, dass die meisten anderen Schüler ihrer Abschlussklasse ihn erlangt haben, also Angehörige dieser Klasse ihn „normalerweise“ besitzen. Solange diese Person selbst die relevante Fähigkeit nicht auf die gleiche Art unter Beweis stellt und den gymnasialen Abschluss erreicht, besitzt sie dieses Recht nicht.
Dieses Argument verstößt damit gegen das Prinzip des moralischen Individualismus, dem zufolge wir jedes Individuum nach Maßgabe seiner Eigenschaften und Fähigkeiten behandeln müssen und nicht nach denjenigen von anderen Individuen (vgl. Ach 1999, 112). [12]
Menschliche Grenzfälle müssen deshalb moralisch berücksichtigt werden, weil sie uns als Menschen näher verwandt sind als Tiere!
Erwiderung: Biologische Verwandtschaft gründet sich auf der Ähnlichkeit oder Übereinstimmung bestimmter Gensequenzen. Aus dieser bloßen biologischen Tatsache lässt sich jedoch keine Schlussfolgerung für die Ethik ableiten. Biologisch weniger verwandte Menschen oder Menschengruppen gegenüber enger verwandten in ihren Grundrechten zu benachteiligen, wird zu Recht als rassistisch abgelehnt. Denn aus biologischen Unterschieden folgt nicht das Recht, das Gleichheitsprinzip zu verletzen, wenn ungeachtet der Unterschiede gleiche Interessen vorliegen.
Das Argument suggeriert auch, dass eine Verwandtschaft bei Menschen mit einer engeren sozialen Beziehung einhergeht. Das ist jedoch nicht der Fall. Häufig ist die Beziehung zu Lebenspartnern oder Freunden enger als zu manchen Familienmitgliedern oder weniger engen Verwandten. Selbst im Fall eines ethischen Dilemmas würden die meisten Menschen sich für diejenigen entscheiden, die ihnen näher stehen (z.B. den Lebenspartner), auch wenn sie mit ihnen weniger eng verwandt sind als mit anderen (z.B. einen Kusin).
Menschliche Grenzfälle müssen deshalb moralisch berücksichtigt werden, weil Menschen stärkere soziale Beziehungen mit ihnen haben als mit Tieren!
Erwiderung: Das kann in Einzelfällen zutreffend sein. So haben Familienmitglieder eines Grenzfalls vermutlich stärkere soziale Beziehungen zu ihm als zu nichtmenschlichen Tieren. Dennoch ist es als Argument nicht verallgemeinerbar. Andere Menschen, bei denen kein Familienmitglied ein Grenzfall ist, können stattdessen stärke soziale Beziehungen zu einem nichtmenschlichen Tier haben. (Bei der derzeitigen Anzahl von sogenannten Haustieren sind die zweiten Fälle auch deutlich in der Überzahl.)
Zudem fehlt (weiterhin, siehe das obige Argument „Menschen haben mehr soziale Beziehungen als Tiere.“) die ethische Relevanz dafür, die Qualität oder Quantität sozialer Beziehungen als ethisches Kriterium für das Vorenthalten von Grundrechten heranzuziehen. Menschen einer bestimmten Hautfarbe haben in der Regel mehr und stärkere soziale Beziehungen zu anderen Menschen der gleichen Hautfarbe, dennoch ist das kein Argument, andersartigen Menschen deshalb Grundrechte abzusprechen.
Menschenwürde, schiefe Ebene und instabile Gesellschaft
Nur Menschen besitzen Menschenwürde, daher muss man auch menschliche Grenzfälle so behandeln, wie man andere Menschen behandeln würde, weil sie Menschen sind.
Erwiderung: Dieses Argument ist keine Verteidigung des Speziesismus, sondern selbst eine Form von Speziesismus. Es besagt nichts anderes als: Menschen haben mehr Rechte, weil sie Menschen sind. (Analog würde „Weiße haben mehr Rechte, weil sie Weiße sind“ abgelehnt.) Begriffe wie „menschliche Würde“, „menschliche Seele“ oder andere metaphysische Zuschreibungen sind solange Leerformeln, wie sie nicht auf (mindestens) eine konkrete Eigenschaft oder Fähigkeit zurückgeführt werden. Falls das möglich ist, kann mit dieser Eigenschaft oder Fähigkeit argumentieren werden. Die Begriffe (Würde, Seele usw.) sind für die Argumentation damit hinfällig.
Die eigene Argumentation konsequent auf menschliche Grenzfälle anzuwenden und ihnen damit Grundrechte abzusprechen, könnte zu einer Erodierung der Menschenrechte führen. Das könnte als Rechtfertigung dafür dienen, auch Menschen, die keine Grenzfälle sind, Rechte abzusprechen. Der Grund dafür liegt darin, dass es keine klaren Grenzen zwischen z.B. dementen und nicht-dementen oder geistig behinderten und nicht-behinderten Menschen gibt, sondern fließende Übergänge. Um dem vorzubeugen, müssen auch menschliche Grenzfälle moralisch berücksichtigt werden!
Erwiderung: Es ist fraglich, ob die Grenze zwischen Menschen, die verschiedene Grade der relevanten Eigenschaft oder Fähigkeit besitzen, unklarer ist, als die Grenze zwischen Menschen und anderen Tieren (vgl. Francione 2008, 183f.).
Wenn Menschenaffen ungefähr das geistige Niveau eines vierjährigen Menschen besitzen, ist die Grenze zwischen einem vierjährigen Menschen und einem Menschenaffen wesentlich unklarer, als zwischen einem zweijährigen und einem vierjährigen Menschen. So könnte man z.B. einen bestimmten Intelligenzquotienten festlegen, mit dessen Hilfe sich eine recht genaue Grenze ziehen ließe. Die Konsequenz wäre, dass Menschen mit einem geringeren Intelligenzquotienten genauso wie nichtmenschlichen Tieren Grundrechte abgesprochen werden müssten. Diese Konsequenz wird von jenen, die dieses Argument benutzen, jedoch nicht gezogen.
Auch trifft die Behauptung der fließenden Übergänge nicht auf menschliche Grenzfälle zu, die aufgrund von Erbkrankheiten behindert sind (z.B. Menschen mit Trisomie 21). Hier gibt es keine fließenden Übergänge und für gesunde Menschen folglich keine Gefahr, in diese Lage zu geraten. Mit diesem Argument lässt sich daher die Ungleichbehandlung von „eindeutigen“ Grenzfällen gegenüber nichtmenschlichen Tieren nicht plausibel rechtfertigen.
Hinzu kommt ein Phänomen, das Soziologen „Entmenschlichung“ (Dehumanisierung) nennen. In Kriegen und ähnlichen Situationen werden Menschen dadurch abgewertet und wird das Absprechen von Grundrechten damit begründet, dass sie „wie Tiere“ seien (vgl. Patterson 2004, Kap. 2). Im Gegensatz zu obiger Behauptung würde das Zusprechen von Grundrechten an nichtmenschliche Tiere die Gefahr der Dehumanisierung unter Menschen zu verhindern helfen.
Die eigene Argumentation konsequent auf menschliche Grenzfälle anzuwenden und ihnen damit Grundrechte abzusprechen, würde ein Klima der Angst erzeugen und die Stabilität der Gesellschaft gefährden.
Erwiderung: Eine Variante dieses Arguments besagt, dass gesunde Menschen in einem Angstzustand leben, weil sie nicht wissen können, ob sie durch einen Unfall in die Lage von menschlichen Grenzfällen geraten könnten und dann keine Grundrechte mehr haben. Dieser Gedankengang entspricht dem vorhergehenden Argument, siehe die Erwiderung dort.
Eine andere Variante des Arguments besagt, dass sich gesunde Menschen grundsätzlich unwohl fühlen, wenn menschlichen Grenzfällen Grundrechte abgesprochen werden, was die Stabilität der Gesellschaft gefährden kann. Dem widerspricht allerdings die historische Erfahrung. In vielen Gesellschaften wurden bestimmten Menschengruppen Grundrechte verwehrt, so z.B. im Nationalsozialismus oder in den Sklavenhaltergesellschaften (inklusive den USA und England bis Anfang/Mitte des 19. Jahrhunderts). Das betraf nicht nur menschliche Grenzfälle, sondern auch gesunde Menschen, bei denen die Grenze zwischen Betroffenen und Nicht-Betroffenen also äußerst undeutlicher war. Trotzdem war die Stabilität dieser Gesellschaften dadurch (vonseiten der nicht-betroffenen Menschen) nie ernsthaft bedroht.
Noch eine Variante lautet dahingehend, dass es möglicherweise nicht die Stabilität der Gesellschaft beeinträchtigt, es vielen Menschen jedoch Unbehagen bereiten würde. Jedoch bereitet auch die jetzige Tierausbeutung vielen Menschen Unbehagen. Wenn dies ein Grund gegen die Ausbeutung von menschlichen Grenzfällen ist, dann ist es auch Grund gegen die Ausbeutung nichtmenschlicher Tiere.
Auch dieses Argument kann somit die Ungleichbehandlung von menschlichen Grenzfällen und nichtmenschlichen Tieren nicht plausibel rechtfertigen.
Nachbemerkungen
Es gibt viele Versuche, die Ungleichbehandlung von Menschen und anderen Tieren zu rechtfertigen. Logisch zwingend und plausibel ist letztlich keiner davon.
Die Argumente im ersten Teil sind größtenteils sogenannte non-sequitur-Argumente: Sie machen eine Beobachtung und ziehen daraus eine Schlussfolgerung, die sich aus dieser Beobachtung nicht ableiten lässt.
Die Argumente im zweiten Teil haben das Problem, dass sie fast immer ethisch irrelevant sind und dass keines in der Lage ist, alle Menschen in die moralische Gemeinschaft einzuschliessen sowie alle anderen Tiere auszuschließen. Würde man diese Argumente konsequent umsetzen, hieße das, dass menschliche Grenzfälle wie Kleinkinder und geistig behinderte Menschen keine Grundrechte besitzen würden.
Um diese Konsequenz zu vermeiden, werden die im dritten Teil behandelten Argumente ergänzt. Manche von ihnen können einige der menschlichen Grenzfälle einschließen, sie sind jedoch sehr konstruiert und unplausibel. Die wenigen, die alle Grenzfälle berücksichtigen, sind schließlich keine Argumente zur Verteidigung des Speziesismus, sondern selbst eine Form von Speziesismus und bleiben daher ohne ethische Begründung: Menschen sollen schlicht deshalb bevorzugt werden, weil sie Menschen sind.
Während sich ein Großteil der Bevölkerung eher auf Argumente aus dem ersten Teil stützt, berufen sich philosophische Überlegungen hauptsächlich auf Argumente des zweiten Teils, die sie dann mit Überlegungen aus dem dritten Teil abzusichern versuchen. Ihr Problem liegt nicht nur darin, dass es bisher kein haltbares Argument aus dem dritten Teil gibt, sodass ihnen das Fundament ihrer Argumentation fehlt. Sondern auch darin, dass die Ermittlung definitiver Unterschiede zwischen Menschen und anderen Tieren meist willkürlich erfolgt und daher die Grenze unklar bleibt (vgl. Francione 2000, 117f.; 2008, 58-61): Wie intelligent muss ein Tier sein, damit man ihm Grundrechte zugesteht? Immer, wenn entdeckt wird, dass nichtmenschliche Tiere eine bestimmte Ebene einer kognitiven Fähigkeit besitzen, kann darauf verwiesen werden, dass sie die nächsthöhere Ebene nicht besitzen. Wenn Papageien bis sechs zählen, heißt es: aber nicht bis sieben; wenn Schimpansen einen Wortschatz von 3.000 Wörtern haben, heißt es: aber nicht von 4.000 Wörtern. Wenn die Fähigkeiten und Eigenschaften von Menschen als Orientierungspunkt gelten, sind nichtmenschliche Tiere automatisch die Verlierer.
Doch wieso sind eigentlich menschliche Fähigkeiten und Eigenschaften der Orientierungspunkt, obwohl es um Nichtmenschen geht? Oftmals werden in ethologischen oder kognitionspsychologischen Tests die Fähigkeiten von nichtmenschlichen Tieren an Aufgabenstellungen ermittelt, die für Menschen ausgelegt sind. Würde dagegen z.B. die Fähigkeit zur Interpretation von Schallwellen zugrunde gelegt, würden Menschen gegenüber Delfinen und Fledermäusen schlecht abschneiden und als „weniger intelligent“ gelten.
Die gleiche Argumentationsweise wäre unter Menschen nicht zulässig: Im Wettkampfsport werden Männer und Frauen getrennt bewertet; es wird nicht das eine Geschlecht als Maßstab für das andere gesetzt. Bei der Bewertung der Fähigkeiten zwischen Menschen und anderen Spezies müsste das gleiche gelten. Den Menschen als Maßstab anzusetzen, beruht auf ethischem Elitismus (vgl. Wolf 1992, 84-86).
Eine andere Schwierigkeit besteht in der Frage, wieso eine bestimmte Eigenschaft oder Fähigkeit Grundlage der ethischen Berücksichtigung sein sollte. [13] Wieso hat ein Individuum kein Recht zu leben, weil es sich selbst nicht im Spiegel erkennen kann? Oder weil es keine komplexen Sätze bilden kann? Solcher Argumentation, die auch als „Intelligentismus“ bezeichnet wird, fehlt die ethische Relevanz, wie ein Blick in unsere Gesellschaft zeigt. Wir sprechen Menschen ohne die Fähigkeit zur Selbsterkenntnis, ohne Sprache, ohne Zukunftsbewusstsein, ohne Autonomie oder mit sehr niedriger Intelligenz nicht die für sie relevanten Grundrechte ab. Denn auch sie haben – wie alle anderen Menschen – ein Interesse an körperlicher und geistiger Unversehrtheit und an ihrem Leben. Diese Grundinteressen haben auch nichtmenschliche Tiere und damit einen Anspruch auf gleiche Berücksichtigung.
Fussnoten
[1] Der Terminus „die Tiere“ ist biologisch sehr weit gefasst und für die folgenden Behauptungen, „die Tiere“ würden bestimmte Eigenschaften oder Fähigkeiten besitzen oder nicht besitzen, wäre es allererst notwendig zu klären, welche Spezies gemeint sind und welche nicht. Da dies ein Text über die ethischen Implikationen ist, beschränke ich mich weitestgehend auf die typischen sogenannten Nutz-, Versuchs- und Haustiere, d.h. einfache Fische und komplexere Tiere. Ich halte es ebenso für falsch, auch weniger komplexe Tiere willkürlich zu töten, wie Muscheln oder Insekten (die in manchen Teilen der Erde auch gegessen werden), dies bedürfte jedoch einer spezifischen Argumentation.
[2] Von sehr seltenen, äußerst streng geregelten Ausnahmefällen abgesehen, da auch Grundrechte keine absoluten Rechte sind. Gemäß der Tierrechtsphilosophie gibt es solche Ausnahmefälle ebenfalls, in denen man nichtmenschlichen Tieren schaden darf (z.B. in Notwehr), wie dies auch für Menschen gilt. Aber um solche Ausnahmefälle soll es hier nicht gehen.
[3] Es ist auch in der Tierrechtsdiskussion umstritten, welche Rechte zu den Grundrechten gehören, die für alle empfindungsfähigen Tiere gelten sollen (z.B., ob das Recht auf Freiheit bzw. Autonomie dazugehört oder nicht). Ein gewisser Konsens besteht jedoch hinsichtlich des Rechts auf körperliche und geistige Unversehrtheit und (damit) das Recht auf Leben. Darauf beschränke ich mich hier.
[4] Es gibt zwei mögliche Verwendungsweisen des Arguments der menschlichen Grenzfälle, die Regan (1982, 116) unterscheidet als die schwache und als die starke Version des Arguments. Anders Pluhar (1995, 63f.), die von der bikonditionalen (entspricht schwach) und der kategorialen (entspricht stark) Version spricht. Die schwache/bikonditionale Version lautet: Wenn menschliche Grenzfälle Rechte haben, dann haben auch zumindest einige nichtmenschliche Tiere Rechte. Wenn verneint wird, dass menschliche Grenzfälle Rechte haben, schließt das sowohl sie als auch nichtmenschliche Tiere aus. Die starke/kategoriale Version lautet: Weil menschliche Grenzfälle Rechte haben, müssten auch zumindest einige nichtmenschliche Tiere Rechte haben. – Wie fast alle Tierethiker benutze auch ich das Argument in der starken/kategorialen Version. Es soll verdeutlichen, dass es innerhalb der bestehenden (sowie vieler plausibel möglicher Formen der) Ethik eine Inkonsistenz zwischen der Behandlung menschlicher Grenzfälle und nichtmenschlicher Tiere gibt, die sich nicht rechtfertigen lässt und die zugunsten der nichtmenschlichen Tiere, ohne Abwertung der Menschen, ausgeglichen werden soll.
[5] Hier geht es vordergründig um die theoretisch-philosophische Rechtfertigung des Speziesismus. Nicht behandelt werden Argumente von der Art, dass sie die praktische Möglichkeit einer veganen Gesellschaft (der Konsequenz von Antispeziesismus und Tierrechten) infrage stellen, so z.B. „Wo sollen all die Tiere hin?“, „Der Mensch ist von Natur aus ein Allesesser“ oder „Konsequenterweise müsste man auch Tiere vom Töten anderer Tiere abhalten“ usw. Siehe dazu das FAQ auf veganismus.ch, insbesondere die Kategorien „Rechtfertigungsversuche“ und „Tierrechte“.
[6] Es wird – meist von den Vertretern des Neuspeziesismus selbst – behauptet, dies sei kein Speziesismus, da sich die Ungleichbehandlung nicht auf die Spezies, sondern auf eine bestimmte Eigenschaft oder Fähigkeit bezieht. Das ist jedoch nur ein rhetorischer Unterschied, da die hier gewählten Eigenschaften oder Fähigkeiten an die Spezieszugehörigkeit gekoppelt sind. Jemanden nicht aufgrund seiner Ethnie, sondern aufgrund einer Eigenschaft wie seiner Hautfarbe zu diskriminieren, ist auch rassistisch (weil auch hier die Eigenschaft an die Ethnie gekoppelt ist). Da bei allen Neuspeziesisten die Eigenschaften und Fähigkeiten der Spezies Mensch als Maßstab gelten (die Argumentation also anthropozentrisch ist), werden alle anderen Spezies zwar nicht aufgrund, aber infolge ihrer Nicht-Zugehörigkeit zu dieser Spezies diskriminiert. Ein Beispiel ist die Argumentation mit dem fehlenden Zukunftsbewusstsein (siehe dort).
[7] Sicherheitshalber sollte die Empfindungsfähigkeit auf die Bewusstseinsfähigkeit ausgedehnt werden, was auch Tiere, deren Empfindungsfähigkeit mittels Genetik oder Medikamenten ausgeschaltet wurde ebenso wie Komatöse einschließt, da man bei diesen nie sicher sein kann, dass tatsächlich keinerlei Empfindungsfähigkeit (was auch rein psychischen Schmerz betreffen kann) vorhanden ist. Zu beachten ist außerdem, dass Empfindungsfähigkeit nicht mit Leidensfähigkeit (das wäre Pathozentrismus) gleichzusetzen ist, sondern mit dem Besitz von Interessen (Näheres zu Interessen s.u.). – Es gibt auch das Argument, sich nur auf die empfindungsfähigen Spezies zu beschränken sei weiterhin speziesistisch, da alle anderen Spezies (einige Tier- und alle Pflanzenspezies) ausgeschlossen würden. Das ist unzutreffend, weil es das zweite Kriterium der Definition von Speziesismus ignoriert. Das erste lautet, dass Speziesismus sich auf Spezies bezieht, das andere aber, dass es eine Diskriminierungsform ist. Lebewesen ohne Bewusstsein können jedoch nicht diskriminiert werden, weil die Diskriminierung oder ihre Folgen nicht erlebt werden können.
[8] Das ist auf aufgeklärte, moderne Gesellschaften bezogen, die Menschenrechte anerkennen, und nicht auf Gesellschaften, in denen universale Menschenrechte abgelehnt werden bzw. nicht etabliert sind.
[9] Dafür ist es nicht notwendig, dass ein Tier dieses Interesse aktiv reflektieren kann oder einen sprachlichen Begriff davon hat. Denn mit Interesse ist kein aktives Interesse gemeint. Das Tier muss weder denken noch artikulieren können „Ich will weiterleben“ oder eine Vorstellung vom Tod haben (fehlendes Todesbewusstsein ist eine Variante des Arguments vom fehlenden Zukunftsbewusstsein). Gemeint ist ein Interesse in Bezug auf etwas: Wenn ein Tier aufgrund seiner Empfindungsfähigkeit Freude vermehren will, ist es in seinem Interesse, diesen Zustand zu bewahren und dazu muss es am Leben bleiben. Das Etwas, an dem das Tier ein Interesse besitzt, ist der Erhalt der Möglichkeit zur Lustmaximierung und das ist zwangsläufig sein Am-Leben-Sein. Dazu und zu dem Einwand, „im Interesse sein von“ (passives Interesse) gelte auch für unbelebte Objekte, sodass z.B. Pflanzen ein Recht darauf hätten, gegossen zu werden, siehe die Erwiderung bei Ach 1999, 86-99. Zur Unterscheidung zwischen aktivem Interesse (desire-based) und passivem Interesse (opportunities-based) siehe auch DeGrazia 2002, 59-61. – Dazu eine Analogie: Man kann nicht sagen, ein Wettkampfsportler habe ein Interesse an einem Wettkampf teilzunehmen (was man z.B. aus der Beobachtung seiner Wettkampfvorbereitungen schließt), aber kein Interesse, daran, dass er nicht verletzt wird (so schwer, dass die Teilnahme nicht möglich wäre). Ohne es explizit geäußert oder auch nur gedacht haben zu müssen, erschließt sich aus der Logik, dass der Sportler das zweite Interesse an Verletzungsfreiheit automatisch schon deshalb haben muss, weil sonst sein erstes Interesse an der Wettkampfteilnahme nicht möglich wäre.
[10] Zum Nachweis, dass Tiere Angst bzw. Furcht empfinden, nennt er die Kriterien: (1) motorische Anspannung wie Wackeligkeit und Nervosität, (2) autonome Hyperaktivität (Schwitzen, erhöhter Puls und verstärkte Atmung, Urinieren und Defäktieren), (3) Hemmung des typischen Verhaltens in neuen Situationen, (4) erhöhte Aufmerksamkeit wie Vigilanz (Wachsamkeit) und Abtastung (DeGrazia 1996, 120).
[11] Ausgelassen werden hier wiederum rein praktische Einwände. Zwei häufige seien erwähnt: 1. Behauptung: Es gibt kaum menschliche Grenzfälle, die Tieren so ähnlich sind, dass man sie vergleichen könnte. – Erwiderung: Das bezieht sich auf intellektuelle Fähigkeiten. Das Kriterium, das hier zugrunde gelegt wird, ist jedoch das der Empfindungsfähigkeit und hierbei liegen die Übereinstimmungen bei über 90 Prozent, da sowohl fast alle menschlichen Grenzfälle und fast alle (hier relevanten) nichtmenschlichen Tiere empfindungsfähig sind. – 2. Behauptung: Ein Vergleich zwischen Grenzfällen und Tieren erübrigt sich aus praktischen Gründen, weil von der Nutzung von Grenzfällen nichts zu gewinnen ist im Gegensatz zur Nutzung von Tieren. – Erwiderung: Die Nutzung von Menschen wäre auch heutzutage bereits lohnend, v.a. im Einsatz für Experimente (‚Tierversuche‘) und die medizinische Lehre; sowie als Medium zur Züchtung von Ersatzorganen. Auch alle anderen Formen der Nutzung analog zu nichtmenschlichen Tieren sind nicht undenkbar.
[12] Dazu eine Analogie: Dass eine Ethnie einen durchschnittlich niedrigeren Intelligenzquotient hat als eine andere, bedeutet nicht (wie es auch die Intelligenzforscher betonen), dass die Angehörigen dieser Ethnie weniger Rechte auf z.B. höhere Bildung haben dürften. Unabhängig von den Eigenschaften und Fähigkeiten, die einer Ethnie „normalerweise“ zukommen, muss jedes Individuum weiterhin individuell bewertet werden. Alles andere wäre rassistisch.
[13] Aus diesem Grund und aus dem Grund, dass dieser Artikel philosophische Rechtfertigungen behandelt und keine kognitionswissenschaftliche Abhandlung über den Geist der Tiere ist, bin ich mit den Gegenargumenten zu bestimmten Eigenschaften oder Fähigkeiten von Tieren einseitig umgegangen. Z.B. mit der Behauptung, dass Affen und Papageien ein Sprachvermögen besäßen. Selbst bei diesen Spezies gibt es nämlich Wissenschaftler, die aufgrund zu geringer syntaktischer Kompetenz die Äußerungen, die diese Tiere hervorbringen, nicht als Sprache gelten lassen wollen. (Hier stellt sich also wiederum die Frage, wie man diese Fähigkeit eigentlich definiert.) Zu diesem Komplex siehe u.a. DeGrazia 1996, 185-198, und Dupré 2005. Wie auch immer: Der Punkt, der am Ende fast aller dieser Betrachtungen stand, war der, dass der Besitz oder Nicht-Besitz dieser Eigenschaften oder Fähigkeiten ethisch nicht relevant ist. Die Hinweise darauf, dass auch verschiedene nichtmenschliche Spezies Sprache, Autonomie, Reflexionsvermögen usw. wahrscheinlich zu einem gewissen Grad besitzen, diente auch dazu, das menschliche Überlegenheitsdenken zu mindern.
Literatur
Ach, J. S. (1999): Warum man Lassie nicht quälen darf. Tierversuche und moralischer Individualismus, Erlangen.
Allan, C. (2005): Tierbegriffe neu betrachtet. Ein empirischer Ansatz: Die Analyse einer Selbststeuerung, in: Der Geist der Tiere, ed. D. Perler & M. Wild, Frankfurt a. M.
AllaAn, C. & Saidel, E. (2005): Die Evolution der Referenz, in: Der Geist der Tiere, ed. D. Perler & M. Wild, Frankfurt a. M.
Damasio, A. R. (1999): The Feeling of What Happens. Body and Emotion in the Making of Consciousness, New York.
de Waal, F. (2000): Der gute Affe. Der Ursprung von Recht und Unrecht bei Menschen und anderen Tieren, München.
de Waal, F. (2008): Primaten und Philosophen. Wie die Evolution die Moral hervorbrachte, München.
DeGrazia, D. (1996): Taking Animals seriously. Mental Life and Moral Status, New York.
DeGrazia, D. (2002): Animal Rights. A Very Short Introduction, Oxford.
Dombrowski, D. A. (1997): Babies and Beasts. The Argument from Marginal Cases, Urbana/Chicago.
Dunayer, J. (2004): Speciesism, Fairborn Court.
Dupré, J. (2005): Gespräche mit Affen. Reflexionen über die wissenschaftliche Erforschung der Sprache, in: Der Geist der Tiere, ed. D. Perler & M. Wild, Frankfurt a. M.
Francione, G. L. (1996): Rain without Thunder. The Ideology of the Animal Rights Movement, Philadelphia.
Francione, G. L. (2000): Introduction to Animal Rights. Your Child or the Dog?, Philadelphia.
Francione, G. L. (2008): Animals as Persons. Essays on the Abolition of Animal Exploitation, New York.
Griffin, D. (2001): Animal Minds. Beyond Cognition to Consciousness, Chicago.
Patterson, C. (2004): „Für die Tiere ist jeden Tag Treblinka“. Über die Ursprünge des industrialisierten Tötens, Frankfurt a. M.
Perler, D. & Wild, M. (2005): Der Geist der Tiere – eine Einführung, in: Der Geist der Tiere, ed. D. Perler & M. Wild, Frankfurt a. M.
Pluhar, E. (1995): Beyond Prejudice. The moral significance of human and nonhuman animals, Durham/London.
Rachels, J. (1990): Created from Animals. The Moral Implications of Darwinism, Oxford/New York.
Regan, T. (1982): An Examination and Defense of One Argument Concerning Animal Rights, in: Ders.: All That Dwell Therein, Berkeley, 113-147.
Regan, T. (2001): Defending Animal Rights, Urbana.
Regan, T. (2004): Empty Cages. Facing the Challenge of Animal Rights, New York et al.
Rollin, B. (1989): Thought without Language, in: Animal Rights and Human Obligations, 2. Aufl., ed. T. Regan & P. Singer, Englewood Cliffs.
Rowlands, M. (1998): Animal Rights. Moral Theory and Practice, 2. Aufl. (2009), New York.
Rowlands, M. (2002): Animals like us, London.
Searle, J. R. (2005): Der Geist der Tiere, in: Der Geist der Tiere, ed. D. Perler & M. Wild, Frankfurt a. M.
Steiner, G. (2008): Animals and the Moral Community. Mental Life, Moral Status, and Kinship, New York.
Tustin, K. & Hayne, H. (2010): Defining the boundary. Age-related changes in childhood amnesia, in: Developmental Psychology 46/2010.
Tye, M. (1998): Das Problem primitiver Bewußtseinformen. Haben Bienen Empfindungen?, in: Bewußtsein und Repräsentation, ed. F. Esken & D. Heckmann, Paderborn.
Wild, M. & Tietz, S. (2006): Denken Tiere? Ein Forschungsbericht, in: Information Philosophie 34/2006.
Wild, M. (2007): Wie sind Tiere? Plädoyer für einen kritischen Anthropomorphismus, in: Tierrechte, ed. Interdisziplinäre Arbeitsgemeinschaft Tierethik Heidelberg (IAT), Erlangen.
Wild, M. (2008): Tierphilosophie zur Einführung, Hamburg.
Wolf, J.-C. (1992): Tierethik, 2., durchgesehene Aufl. (2005), Erlangen.
Wolf, J.-C. (2008): Argumente pro und contra Tierrechte, in: Information Philosophie 36/2008.
© 2011 Martin Pätzold
Martin Pätzold ist bei der Tierrechtsinitiative Maqi aktiv und studiert zurzeit an der Freien Universität Berlin. Von ihm stammen auch die Artikel:
Weitere tif-Materialien zum Thema
- Mensch, Tier, Natur, Info-Dossier von tier-im-fokus.ch (tif)
- „Wir spiegeln uns gern in Tieren“, Interview mit Markus Wild
- „Wir sollten Willens sein, Verantwortung zu übernehmen“, Interview mit Gary Steiner
- Über kulturelle Widersprüche im Umgang mit Tieren, von Martina Späni
- Der Mensch: ein Tier wie sie?, von Klaus Petrus

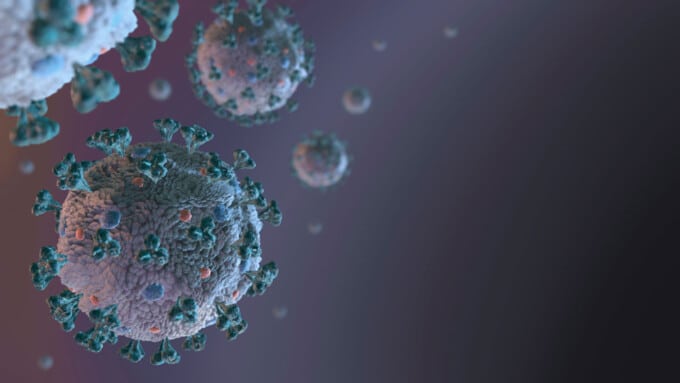







9 Kommentare
Liebe:r Napo
Danke für deine Fragen! Ich erlaube mir, darauf zu reagieren:
1) Ich meine ja. Ich finde den Grundsatz „in dubio pro animali“ hilfreich. Wenn uns also die Infos fehlen, um die Folgen einer Handlung für ein Individuum oder eine Gruppe abzuschätzen, sollten wir im Zweifelsfalle im Sinne der Tiere entscheiden.
2) Es geht grundsätzlich darum, das Vermeidbare zu tun. Ein Tier zu essen, ist in unserer Wohlstandsgesellschaft vermeidbar. Zu fliegen in den meisten Fällen auch. Also sollte man moralisch gesehen auf beides verzichten. Beides kann sich aber weiterentwickeln: So könnten dereinst Burger aus dem Reagenzglas oder Flugzeuge ohne CO2-Ausstoss verfügbar werden.
Ich hoffe, das hilft dir weiter. Dir ebenso eine schöne Weihnachtszeit!
Tobi
Hallo,
ich komme etwas spät zu Party. Sehr gut geschriebener Artikel! Ich bin kein Veganer und versuche grad für mich selber dem Thema auf den Grund zu gehen. Dabei will ich deiner Argumentation contra Tieren Leid zuzufügen nicht widersprechen. Allerdings sind beim Lesen (eventuell naive) Fragen entstanden. 1: Reicht es schon aus, Tieren ein ‚eventuelles‘ Zukunftsbewusstsein (es könnten unterbewusste Entscheidungen sein oder aber auch bewusste, ist aus den genannten Beispielen nicht ersichtlich) zuzusprechen, um die Beweislast den ‚Speziesisten‘ zuzuschreiben, wenn der Gesellschaftliche Konsens des Tiere Essens seit so langer Zeit besteht?
2. Wenn ich an einem von 365 Tagen ein Tier esse, bin ich nach Definition ein Speziesist. Warum soll das schlimmer sein (und gesetzlich verboten) als wenn ich einen Langstreckenflug mache, der in seiner Konsequenz sehr viel Co2 Ausstößt, Lebensräume zerstört, Menschen Leid zufügt und Tierarten ausrottet? Natürlich könnte man auch hier den Vergleich zum More am Menschen heranziehen. Aber ist es nicht so, dass die Definition (an einem Tag einen Menschen umbringen, dann bist du Mörder) daher kommt, dass sonst unsere gesellschaftliche Stabilität in Gefahr wäre, wenn man nicht so denken würde? Ich frage mich deshalb wirklich, ob es schlimmer ist, ein Tier zu töten und zu essen, das artgerecht gehalten wurde, als einen Langstreckenflug zu machen? Klar, es gilt beides zu vermeiden aber muss man das nicht jedem selbst überlassen, wo er die großen Einschnitte zum Wohle der Allgemeinheit macht? Ich glaube, die harte Abgrenzung in Speziesisten und Antispeziesisten ist das, was bei mir bei der Diskussion einen faden Beigeschmack erzeugt, in einer Diskussion, in der gerade die Komplexität derart klare Abgrenzungen nur schwer erklären kann.
Hoffe das war Verständlich! 😉 Würde mich sehr über eine Antwort freuen!
Lg und schöne Weihnachtszeit,
Napo
Aus deiner Frageformulierung kann ich nicht ganz ersehen, was genau du fragen willst. Auf die Frage, wie ich diese Rechte unterscheide, wäre die Antwort: anhand der Intensität, mit der das Wohlergeben des Lebewesens betroffen ist. Auf die Frage, woraus ich dies ableitet, wäre die Antwort: aus grundlegenden biologischen Kenntnissen. Aber wie gesagt, bin ich unsicher, ob dies deiner Frageintention entspricht.
Kannst du eine kurze Erklärung dazu geben, wie du Grundrechte und weiterführende Rechte unterscheidest und woraus du diese Unterscheidung ableitest?
Vielen Dank für diesen brillanten Aufsatz!