Über kulturelle Widersprüche im Umgang mit Tieren
Die menschliche Kultur ist nichts Eindeutiges, sie ist voller Widersprüche. Geht es um das Verhältnis des Menschen zu den Tieren, so sind diese Widersprüche vielfältig und irritierend. Man schützt die Tiere, beobachtet und streichelt sie, spielt mit ihnen, sperrt sie ein und wirft sie in die Pfanne. Gut so? Ein Essay von Martina Späni (tif).
Archiv
Dies ist ein Beitrag von unserer alten Website. Es ist möglich, dass Bilder und Texte nicht korrekt angezeigt werden.
Zuerst die Menschen auf Erden – ein Gedankenexperiment
Schöpfungsgeschichte und Evolutionsbiologie besagen in einem Punkt beide das Gleiche: Menschen lebten schon immer inmitten von Tieren – als Tiere unter Tieren oder als Gottes Ebenbilder inmitten von Tieren. Stellen wir uns aber für einmal vor, dass Menschen die Erde besiedelten, bevor die Tiere erdgeschichtlich auftraten.
Eines Tages landeten zum grossen Staunen der Menschen in den riesigen Urwäldern Südamerikas, Afrikas, Australiens, Europas und Asiens Raumschiffe voller Tiere: Archen des Alls, vielleicht Gerettete von einem fernen Planeten. Nun, was würde der homo sapiens – Erfinder von modernen Spitalbetten, von Facebook, Gleichberechtigungsbüros, Nichtraucherlokalen und Designerkleidern – angesichts dieser Tiere tun?
Pfähle einschlagen und elektrifizierte Drähte spannen? Tiere einfangen und einsperren? Züchter werden? Einzelkäfige für Muttersauen und Hallen für Tausende von Mastschweinen bauen, Spaltböden einziehen, Schlachthäuser errichten? Plastikschürzen umbinden, in hohe Stiefel steigen, den Tieren in engen Gängen mit Bolzengewehren aufwarten? Sie betäuben und ihren Körper öffnen, damit das noch pulsierende Blut die Fleischfasern zum menschlichen Verzehr freigibt?
Würden wir sozialversicherte Individuen des 21. Jahrhunderts mit Freude daran teilhaben wollen, dass Elefanten in der Manege zum Tanzen, Löwen zum Sprung durch brennende Reifen und Hengste vor schönen Frauen zum Aufbäumen gebracht werden? Würden wir Menschen nach der Landung der Archen des Alls, im Zeitalter von Wassergeburten und Feng Shui, das mit gegerbten Tierhäuten überzogene Sofa entwickeln, unsere Köpfe mit Tierschwänzen schmücken und Tomatensauce mit einem Hornlöffel schöpfen wollen?
Würden wir Menschen von heute – gesetzt der Fall, wir hätten noch nie Rinder, Schweine und Hühner gesehen – Kälber von Kühen, Ferkel von Muttersauen und Küken von Henne und Hahn trennen, würden wir Krebsmäuse erfinden, das Rückenmark von Affen durchtrennen und an offenen Tierschädeln Elektroden ansetzen wollen, würden wir Schweine im Schnee vergraben und über Monitore und Sensoren nachvollziehen, wie lange sie überleben? Würden wir Deodorants in Kaninchenaugen sprühen?
Die Ungleichzeitigkeit des Gleichzeitigen

Natürlich braucht es auf alle diese Fragen keine Antworten, weil es auf ein weit hergeholtes Gedankenexperiment keine vernünftigen Antworten geben kann. Aber die fiktive Konstellation macht insofern Sinn, als sie uns auf etwas Wesentliches aufmerksam macht: Dass unser Verhältnis zu den Tieren im Vergleich zu andern Ausschnitten unserer Kultur zeitwidrig, sprich: anachronistisch ist.
Wir praktizieren auf hohem Niveau einen Umgang mit Tieren, den wir in andern Zusammenhängen fassungslos als grob, widerwärtig, gewalttätig, gefühllos, sadistisch oder als archaisch bezeichnen würden.
Ein Anachronismus also: Wir halten uns für zivilisiert und mitfühlend, gleichzeitig sind wir gegenüber vielen anderen Lebewesen gewalttätig und empfinden das als normal, sofern wir es denn überhaupt zur Kenntnis nehmen (wollen).
Kultur ist kein konzises Konstrukt, sondern eine zeitbedingte Ablagerung von Verhalten und Sinndeutungen, die sich irgendwann durchzusetzen verstanden. Es sind Sedimente verschiedener historischer Zeiten, und Widerspruchslosigkeit ist kein Entwicklungsziel.
Vier Schubladen für einen Fisch
Hierzulande zeigt man Kindern, kaum können sie den Kopf aufrecht halten und krabbeln, das Bilderbuch „Der Regenbogenfisch“. Wenig später essen sie Fischstäbchen, sie besuchen einen Zoo und bestaunen das Leben im Aquarium – und mit etwas Glück, entdecken sie in einem Gewässer einen Fisch.
Viermal Fisch: Im Bilderbuch ist der Fisch ein leidensfähiges moralisches Subjekt; auf dem Teller ein unkenntliches Objekt, das verspiesen wird; in der gut einsehbaren Welt des Aquariums ein vielleicht faszinierendes, vielleicht banales, aber sicherlich hilfsbedürftiges fremdes Wesen und ausgerechnet in freier Natur ein fast unsichtbares Tier.
Die diversen Schubladen, in denen die menschliche Mainstreamkultur die unterschiedlichen Konzepte über Tiere versorgt hat, sind gerade für Kinder mit Irritationen, ja Erschütterungen verbunden. Denn sie kopieren nicht nur, sondern machen auch eigenständige Erfahrungen, die Vorgelebtes und Vorgedeutetes zu konkurrenzieren vermögen.
Ist das ein Tier in der Pfanne?
Wieso schützt man Tiere, beobachtet sie, streichelt sie, spielt mit ihnen und wirft sie trotzdem in die Pfanne?
Kinder stossen meist von selbst auf diesen offensichtlichsten Widerspruch im menschlichen Umgang mit Tieren: dass nämlich Tiere einen hohen und zugleich erbärmlichen Status unter uns Menschen haben. Dieser Widerspruch wirft auch ein Licht auf die Zwiespältigkeit von uns selbst als Menschen.
In unübertrefflicher Weise schildert dies die amerikanische Autorin Patricia Highsmith. In der Kurzgeschichte „Die Schildkrötensuppe“ ermordet ein Knabe nachts seine Mutter mit einem Fleischmesser. Warum? Die Mutter bringt eine Schildkröte mit nach Hause, die sie zunächst dem Jungen zum Spielen überlässt. Sie fordert die Schildkröte dann zurück und schickt den Jungen in den Keller, damit er etwas holt. Sie schickt ihn deswegen, weil sie nicht will, dass der Junge sieht, wie sie die noch lebende Schildkröte ins heisse Wasser wirft. Aber, so will es die Geschichte, er sieht es dennoch.
Die Mutter weiss um die Grausamkeit ihrer Handlung, was sich daran zeigt, dass sie den Jungen in den Keller schickt. Sie vermag zwar die Perspektive des Jungen einzunehmen, macht sich diese aber trotzdem nicht zu eigen und führt die grausame Handlung aus. Abgespaltene, entfremdete Emotionen einer erwachsenen Person.
Testergebnis: Exekution

Meine Entdeckung als Kind, dass Tiere durch Aufzucht und Tötung in Lebensmittel umgewandelt werden, provozierte ebenso eine Reaktion, wenn auch eine ganz entgegengesetzte. Ich akzeptierte die toten Tiere auf dem Familientisch als kulturellen Tatbestand und meinte, wenn ich tote Tiere esse, muss ich konsequenterweise auch das Töten von Tieren verstehen und ertragen.
Ich war damals sieben. Bauernhöfe gab es genug in unserem Dorf, und so ergab es sich, dass ich bei einer Tötung von Kaninchen dablieb und nicht weglief. Das erste Tier wurde aus dem Stall genommen und mein Kinderfreund wurde vom Vater angewiesen, das zappelnde Lebewesen an den Ohren festzuhalten. Ich sah genau hin, fiebernd. Der Vater schoss dem Tierchen in den Kopf.
Ich rannte weg. Es war nicht einfach der Tod, der mich erschreckte, sondern das, was ich heute als Exekution bezeichnen würde: Das Zusammentreffen von kreatürlicher Hilflosigkeit und kompromissloser, kalkulierter menschlicher Gewaltanwendung.
Erwachsen werden, heisst: Widersprüche akzeptieren
Obwohl die Szenerie aus den 1970er Jahren nur eine winzige Vorstellung darüber vermittelt, wie Menschen mit den von ihnen gezüchteten oder eingefangenen Milliarden von Nutztieren umgehen, enthält sie doch eine erfahrbare Wahrheit: Die Verfügung des Menschen über Tiere ist nichts Banales, sondern überaus irritierend. Und sie ist in diesem Ausmass nur mit organisierter, gelernter und tradierter Gewaltanwendung möglich.
Die Widersprüche, die Kinder in den kulturell vermittelten Tierkonzepten entdecken, lösen sich beim Älterwerden nicht einfach auf, denn es sind konstitutive Widersprüche der menschlichen Kultur. Aber die Widersprüche verlieren an Gewicht: sie werden normal. Man ist erwachsen geworden.
Die Schweizerische kynologische Gesellschaft hat jüngst eine Sondernummer über die Ernährung von Hunden publiziert; dass das geliebte Haustier potentiell andere liebenswürdige, kluge, leidensfähige und sozial begabte Kreaturen in seinem Fressnapf verspeist, wird mit keinem Wort erwähnt. Rational kann man derlei deshalb nicht nennen, weil Vernunft Vergleiche anstellt, Widersprüche thematisiert und daraus Konsequenzen zieht.
Warum müssen ausgerechnet Hühner glücklich sein?
Der Widerspruch zwischen praktizierter Tiernutzung und naheliegender Empfindung für das individuelle Lebensrecht von Tieren bleibt virulent. Dieser grundsätzlich nicht zu beruhigende Widerspruch zeigt sich in Konstrukten wie der „artgerechten Haltung“ und dem „glücklichen Huhn“. Das „glückliche Huhn“ ist die Verkörperung eines solchen Widerspruchs, den man mittels Werbung zu beruhigen versuchte.

Das Glück des Legehuhns ist ein relatives Glück, das vor dem Schreckensszenario „Käfighaltung“ aufgebaut wurde.
Der Rest des Glücks ist Propaganda: Das Huhn spaziert in Werbeblöcken des 21. Jahrhunderts durch Kuhställe des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, es wandert in der weiten Landschaft herum und hinterlässt da und dort ein Ei. Abends kommt es in den sichern Hühnerstall, damit der Fuchs es nicht fressen kann.
Hunderttausende Franken teure Kinderbuchromantik für Fünfjährige. Die Wirklichkeit eignet sich nicht für Werbung.
Denn das reale Leben des Huhns unterscheidet sich in vielen Aspekten von dieser gebastelten Idylle. Als industrieller, vom Ausland abhängiger Standardorganismus liefert es Eier oder Fleisch und es lebt nicht alleine, sondern inmitten von tausenden, zehntausenden, hunderttausenden Hühnern. Masthühner werden nach 23 bis 60 Tagen geschlachtet. Legehennen nach 18 Monaten getötet, die männlichen Legeküken schon am Tag des Schlupfs geschreddert oder vergast. Ein wildes Huhn würde acht bis zwölf Eier jährlich legen, Legehybriden müssen es auf 300 Eier bringen. Dann sind sie unrentabel. Wer sie, eingesperrt in gestapelten Plastikkisten, auf ihrem Weg zum Schlachthof antrifft, sieht nur Lebensmüde. Heute werden sie vermehrt direkt vor dem Stall vergast und tot verladen: Zielort Biogasanlage, dem Inbegriff CO2-neutraler Energieerzeugung.
Werbetauglich?
Auch ein getötetes „glückliches“ Huhn war im Leben ein unglückliches Huhn. Und bleibt es deshalb auch als totes. Der Schriftsteller und Literaturnobelpreisträger Isaac B. Singer wurde bei einem Bankett gefragt, warum er kein Huhn esse, ob es ihm denn nicht gut ginge. Der Literat von Weltrang meinte daraufhin: Oh, mir geht es gut, aber dem Huhn nicht.
Leben im Angesicht von Widersprüchen?
Die Werbung über Milchkühe und Legehennen passt nicht zufällig in jenen Stapel von Bilderbüchern, die wir als Kinder über das Leben von Tieren auf dem Bauernhof lasen und die in Verbindung mit der nationalen Selbststilisierung der Schweiz als Land der würzigen Bergwiesen, der geländegängigen Kühe und der weltberühmten Käse als psychedelische Injektion bis heute nachwirkt.
Die Werbung bedient jene heile, schöne Schublade, die wir uns als Kinder in unseren Köpfen und Emotionen einrichteten: die Mär vom glücklichen Tier in menschlicher Obhut.
Die Tiernutzungswirklichkeit gehört nicht in diese Idyllenschublade. Wie wir tatsächlich mit Nutztieren umgehen, eignet sich weder für Kindererziehung noch für Werbung noch für Öffentlichkeitsarbeit.
Trotzdem: Wenn uns die Werbung und die Welt der Kinderbücher sympathisch erscheinen, weshalb orientieren wir uns im wirklichen Leben nicht an dem, was wir an ihnen mögen? An einem lebensfrohen, eigensinnigen Leben sozialer Lebewesen? Und zwar im Alltag und nicht bloss in der Fiktion?
Damit das möglich wäre, müsste die Mainstreamkultur zunächst die hässliche Realität zur Kenntnis nehmen, welche die Werbung zudeckt und die Erziehung tabuisiert.
Und das ist offensichtlich ziemlich schwierig und wenig rentabel.

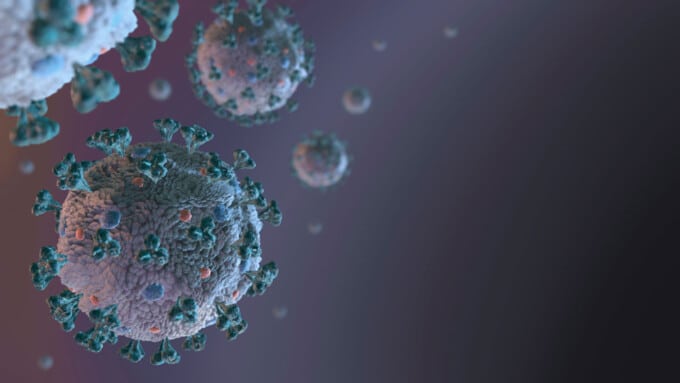






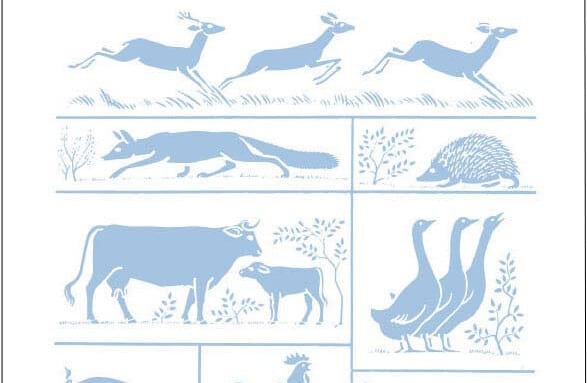
Noch keine Kommentare