Die Ankunft der Tiere in der Welt des Geistes
Ein neuer Sammelband bringt Positionen der Tierethik und ihre Anwendung in den Human-Animal Studies zusammen.
Archiv
Dies ist ein Beitrag von unserer alten Website. Es ist möglich, dass Bilder und Texte nicht korrekt angezeigt werden.
Tiere wandern nun schon seit Längerem in die Geistes- und Kulturwissenschaften ein, ja so zahlreich sind die Migrationen, dass inzwischen von einem animal turn gesprochen wird. Nicht nur hat sich eine neue, Disziplinen-übergreifende Forschungsrichtung etabliert – die sogenannten Human-Animal Studies –, auch eine überwältigende Anzahl an Publikationen in diesem Feld zeugt von einem gesteigerten Interesse der Forschung an den nicht-menschlichen Tieren. [1]
Die Human-Animal Studies haben zum Ziel, transdisziplinär Beziehungen und Verhältnisse zu untersuchen, die zwischen Menschen und anderen Tieren herrschen – und dies nicht länger in einem herkömmlichen geisteswissenschaftlichen Sinne, wo Tiere stets nur als (Kunst-)Objekte oder Symbole gedeutet wurden (etwa: Krähen als Todesboten bei Van Gogh), sondern Tiere sollen als Subjekte und eigenständige Akteure wahrgenommen werden (etwa: Welchen Einfluss üben reale Tiere auf die Malerei aus? Wie sind Tiere an der Kunst des 19. Jahrhunderts direkt beteiligt? (Mensch denke nur an Pinsel aus Dachs- und Marderhaar oder Sepiatinte.) Wie beeinflusst Malerei unsere Einstellung zu Tieren? etc.).
Angeregt wurden die Human-Animal Studies durch das Erstarken der Tierrechtsbewegung in der Gesellschaft einerseits und die philosophische Tierethik andererseits. Der vorliegende Sammelband Tierethik transdisziplinär versucht nun wichtige Positionen der Tierethik, vor allem aber ihre Implementierung in die Kultur- und Literaturwissenschaft sowie die Didaktik vorzustellen. Mit exemplarischen Texten gibt er damit einen guten Überblick, was unter Human-Animal Studies zu verstehen ist.
Positionen der Tierethik
In einem ersten Beitrag leistet Dieter Birnbacher, emeritierter Philosophie-Professor mit Schwergewicht Ethik, einen gelungenen und gut lesbaren Überblick über die Geschichte der Tierethik. Birnbacher betont, dass es erst seit der Aufklärung überhaupt denkbar sei, den Tieren einen moralischen Status zuzuweisen. Davor sei dem Menschen nicht eine Sonderstellung, sondern schlicht eine Alleinstellung als Gegenstand moralischer Berücksichtigung zugekommen.
In der Diskussion der aktuellen Tierethik stellt Birnbacher vor allem die Frage des Speziesismus ins Zentrum: Er unterscheidet dabei zwischen einem starken und einem moderaten Speziesismus. Der starke Speziesismus ist schnell erledigt: Dass die Zugehörigkeit zu einer biologischen Art für sich allein genommen schon moralisch relevant sein soll, leuchtet partout nicht ein. Dies ist auch eine Alltagserfahrung: Die wenigsten Leute würden sich wohl auf den Homo Sapiens und sein Genom berufen, wenn es ihnen darum geht, die Höherstellung des Menschen gegenüber den anderen Tieren zu rechtfertigen.
Eine grössere Herausforderung scheint mir hingegen Birnbachers Sicht eines moderaten Speziesismus zu sein, den er selber vertritt: Nicht biologische Merkmale begründen hier die Sonderstellung des Menschen, sondern bestimmte Fähigkeiten, die gemeinhin mit dem Personen-Status verbunden sind: Rationalität, Selbstbewusstsein, Zukunftsperspektive, Willensfreiheit und Moral etwa. «Diese Fähigkeiten reichen so weit über das, wozu nicht-menschliche Lebewesen fähig sind, hinaus, dass sie förmlich dazu zwingen, den Wesen, die über diese Fähigkeiten verfügen, eine besondere Wertigkeit […] zuzuschreiben, die sie über die übrigen Naturwesen erhebt.» (S. 35) Dies scheint mir exakt zu sein, was die meisten Leute in einem alltäglichen Sinne meinen, wenn sie emphatisch vom «Menschen» sprechen. Und dies scheint mir auch zu sein, was letztlich der «Menschenwürde» des Artikels 7 der Bundesverfassung zu Grunde liegt (neben einer christlichen Tradition wohl).
Birnbacher vertritt diese Position, bleibt jedoch nicht dabei stehen: Nicht diese besonderen Fähigkeiten alleine sind der Grund für eine Höherstellung des Menschen – denn der blosse Fakt, dass jemand über eine bestimmte Fähigkeit verfügt (z.B. über ein Ich-Bewusstsein), ist noch kein Grund, ihm oder ihr eine besondere moralische oder rechtliche Position einzuräumen. Relevant sind jedoch Bedürfnisse und Interessen, die aus diesen Fähigkeiten erwachsen: So meint Birnbacher z.B., dass Menschen offensichtlich über die Fähigkeit verfügen, sich differenziert über ihre eigene Zukunft Gedanken zu machen; daraus würden sich weitergehende Bedürfnisse und eine erhöhte Leidensfähigkeit ergeben: Menschen können z.B. im Voraus darunter leiden, dass ein Jobverlust oder eine schwere Krankheit droht. Sie haben ebenso ein Verständnis für den bevorstehenden Tod sowohl im eigenen wie auch im Leben ihrer Nächsten. «Insofern gibt es gute Gründe, Menschen in der Tat weitergehende Rechte als Tieren zuzuschreiben.» (S. 36)
Birnbacher geht sogar soweit, dass die (behauptete) höhere menschliche Leidensfähigkeit eine Ungleichbehandlung von Menschen und anderen Tieren auch dann rechtfertige, wenn grundsätzlich gleichwertige Interessen einander gegenüberständen. Auch wenn er natürlich nicht bestreitet, dass Fragen um die Reichweite und Qualität tierlicher Empfindungsfähigkeit keineswegs abschliessend beantwortet sind (sondern im Gegenteil laufend revidiert werden müssen – mensch denke etwa an das Schmerzempfinden von Fischen oder Kraken), glaubt Birnbacher dennoch sagen zu können: Man werde doch annehmen dürfen, «dass etwa ein Zugpferd weniger unter seiner Last leidet als ein zu ähnlichen Zwecken eingespannter Mensch.» (S. 37)
Tatsächlich würden die meisten Menschen dieser Aussage wohl spontan zustimmen – allerdings könnte m.E. gerade unsere Unsicherheit in der Beurteilung tierlicher Leidensfähigkeit eine abolitionistische Position nahelegen: Solange wir uns nicht über das Ausmass ihres Leidens im Klaren sind, sollten wir grundsätzlich darauf verzichten, Tiere zu züchten, einzusperren, vorzuführen, auszubeuten, zu töten. Birnbacher sieht diese Position durchaus – seine Reaktion darauf ist schwach: Er hat nichts zu entgegnen, als dass diese «jede Nutzung von Tieren zu menschlichen Zwecken unmöglich machen» (S. 40) würde. Tatsächlich?!
Rechte für Tiere
Eine weitergehende Haltung vertritt bekanntlich der Amerikaner Tom Regan; sie wird im Aufsatz «Tom Regans Philosophie für Tierrechte» von Erwin Lengauer vorgestellt. Regan (1938-2017) gehört zusammen mit Peter Singer (*1946) und Mary Midgley (1919-2018) zu den Begründer*innen der modernen Tier-Ethik, sein Buch The Case for Animal Rights (1983) gilt als Klassiker. Lengnauer fokussiert in seinem Aufsatz darauf, wie und weshalb Regan Rechte für nicht-menschliche Tiere begründet.
Eine zentrale Rolle spielt dabei der Begriff «inhärenter Wert»: Alle Lebewesen, die über diesen inhärenten Wert verfügen, sollen den Status der «Unverfügbarkeit» und damit moralische Grundrechte erhalten. Dies im Unterschied und in expliziter Abgrenzung zur utilitaristischen Tradition, die vor allem mit Interessen von Individuen argumentiert [2]: Der Utilitarismus kümmert sich nicht um Rechte und Pflichten, sondern nur um die Konsequenzen von Handlungen. Individuen – menschliche und gewisse tierliche – haben offensichtlich ein Interesse daran, Leid zu vermeiden und Freude zu vermehren. Gut ist eine Handlung also dann, wenn (die Gesamtsumme an) Freude, schlecht, wenn Leid vermehrt wird. Regan wirft dieser Richtung nun vor, sie behandle Individuen als blosse «ersetzbare Behälter» (replaceable receptacles) für Freude und Leid – nach seiner (vom deutschen Philosophen Immanuel Kant beeinflussten) Sicht können Individuen jedoch nicht gegeneinander aufgewogen werden, sie sind um ihrer selbst willen zu respektieren, es kommt ihnen eben ein inhärenter Wert zu. Und damit auch moralische Rechte.
Welche Individuen aber verfügen über diesen inhärenten Wert? Regan stellt hier das Kriterium auf, für das er vielleicht am bekanntesten geworden ist: das Kriterium «Subjekt eines Lebens» (subject of a life). Und wer ist Subjekt eines Lebens? Regan bringt dafür eine Reihe von Aspekten, zentral scheint mir zu sein, dass Subjekte eines Lebens nicht nur in der Welt sind, sondern der Welt gewahr sind, dass sie merken, was darin mit ihnen geschieht – mit ihren Körpern, ihrer Freiheit, ihrem Leben als solchen –, und dass dies für sie von Bedeutung ist. Wer dieses Kriterium erfüllt, gehört zur moralischen Gemeinschaft, muss moralisch berücksichtigt werden.
Es wird offensichtlich: Mit dem Subjekt-eines-Lebens-Kriterium erweitert sich diese Gemeinschaft ganz erheblich über den Menschen hinaus, auf (mindestens) den grössten Teil der Wirbeltiere, vielleicht sogar auf gewisse Kopffüsser. Und aus dieser Erweiterung muss für Regan selbstverständlich ein radikaler gesellschaftlicher Wandel folgen: die Anerkennung von tierlichen Grundrechten und damit die Abschaffung der Nutztierhaltung ebenso wie die der Tierversuche, der Jagd, der Nutzung von Tieren für Sport und Unterhaltung – also das, was als Abolitionismus bezeichnet wird.
Sterbliche Mitgeschöpfe
Eine weitere tierethische Position stellt Friederike Schmitz in ihrem Aufsatz zur Philosophin Cora Diamond vor, «Die Schwierigkeit der Wirklichkeit»: Diamond (*1937) kritisiert seit den späten Siebzigerjahren die akademische Tierethik – die sich wie gezeigt auf Fähigkeiten und Interessen (Singer) oder Rechte (Regan) fokussiert – als zu abstrakt, als zu theoretisch. Wenn wir Tiere als «sterbliche Mitgeschöpfe» sehen, wenn wir uns vom unendlichen tierlichen Leid, den grauenvollen Abgründen der Tierindustrie unmittelbar berühren lassen, entsteht von selbst eine andere Einstellung. Dafür braucht es nach Diamond keine rationalistische Argumentation, die versucht Prinzipien oder Rechte zu begründen, sondern schlicht Mitgefühl.
Sie bringt ein überzeugendes Beispiel: Wir würden niemals argumentieren, dass wir Menschen nicht töten und essen, weil wir gegenseitig unser Interesse achten, weiterzuleben. (Dann wäre es nämlich möglich, Leichen zu essen, da diese keine Interessen mehr haben.) Wir töten und essen keine Menschen, weil wir uns als Menschen achten, weil wir uns als Menschen in sozialer Praxis begegnen. Umgekehrt – wie es bei Birnbacher schon offensichtlich wurde – kann die Argumentation mit Interessen nämlich auch dazu benutzt werden, Tier-Nutzung zu rechtfertigen: Da Tiere kein Verständnis von Zukunft hätten, könne bei ihnen auch kein Interesse am Weiterleben existieren – es sei somit unproblematisch oder zumindest weniger problematisch, sie zu töten. [3]
Gegen solche Rationalisierungsversuche setzt Diamond schlicht unsere unmittelbare Betroffenheit; diese ist in der Begegnung mit Tieren nicht von der Hand zu weisen – die allermeisten Menschen verspüren sie, wenn sie mit Leiden, Schmerzen, Angst, Verletzungen oder dem Tod von Tieren konfrontiert werden: Ein geschwächter Igel im Garten, ein Koala mit Brandwunden in Australiens Buschfeuer, die Panik der Hündin während der 1.-August-Knallerei – niemand denkt in solchen Situationen wohl über Empfindungsfähigkeit und daraus resultierende Interessen nach. Und dies gilt ebenso oder gar verstärkt, wenn Menschen direkt mit Tierfabriken und Schlachthöfen in Kontakt kommen. «Es geht nicht darum, zuerst nachzuweisen, dass Tiere Eigenschaften besitzen, die wir ebenfalls haben und die als Grundlage dafür dienen, dass Tiere als mögliche Opfer von Ungerechtigkeit gelten dürfen. Vielmehr geht es um eine bestimmte Reaktion angesichts dessen, was ihnen angetan wird: ein Schmerz und ein Abscheu, deren Äusserung die Sprache der Ungerechtigkeit voraussetzt» (S. 228). Die Autorin Friederike Schmitz weist darauf hin, dass diese Überlegungen auch für den Aktivismus wichtig seien: Denn zu oft scheinen rationale Argumente in der Auseinandersetzung mit Speziesist*innen nicht wirklich zu fruchten.
Tiere in Soziologie, Literatur und Didaktik
Den grösseren Teil des Sammelbandes bilden jedoch wie erwähnt exemplarische Aufsätze aus dem Bereich der Human-Animal Studies. So zeigt etwa Ulrike Schmid in ihrem soziologischen Text «Jägerinnen unter Jägern», welchen Gewinn Frauen aus der Beteiligung am nach wie vor männlich beherrschten Feld der Jagd ziehen (nämlich einen symbolischen Nutzen als Komplizinnen männlicher Herrschaft).
«Tiere sind die besseren Menschen» – diese Sicht ist in den sozialen Medien nicht selten zu finden. Pamela Steen untersucht sie in ihrem Aufsatz aus sprachwissenschaftlicher Perspektive, und dies anhand von Kommentaren zu einem viralen Video: Darin ist zu sehen, wie ein Braunbär im Budapester Zoo eine Krähe aus dem Wasserbecken zieht.
Rettet der Bär den Vogel absichtlich? Handelt er also – notabene als Raubtier – selbstlos und moralisch? Die Linguistin interessiert sich in ihrem Text weniger für die Vorgehensweise des Bärs, sondern vor allem dafür, wie diese in den Kommentaren diskutiert wird.
Können sprechende Tier-Figuren in literarischen Texten dazu geeignet sein, realen Tieren eine Stimme zu geben? Können sie zur Stärkung und Sichtbarmachung von Tieren beitragen? Oder wiederholen Autor*innen, die sprechende Tiere in ihren Romanen auftreten lassen, nur das Machtverhältnis, dass zwischen Menschen und Tieren in Realität herrscht? Tiere in einem menschlichen Sinne sprechen zu lassen, bedeutet dies nicht stets: Tiere zu anthropomorphisieren, sie also damit auszustatten, was ihnen grundsätzlich als Manko angelastet wird (eben die Sprachfähigkeit)? Und damit die Mensch-Tier-Grenze letztlich zu zementieren? Solche Fragen untersucht die Germanistin Andrea Klatt in ihrem Text «Can the Animal Speak? Sprechende ‹Tiere› in literarischen Texten».
Im letzten Teil des Bandes geht es um die Relevanz der Tierethik im schulischen Unterricht: So plädiert etwa Gabriela Kompatscher für einen «tiersensiblen Literaturunterricht»: Literarische Texte, in denen Tiere auftreten, stossen in der Regel auf relativ grosses Interesse bei Schülerinnen und Schülern. Ausgehend von solchen Tierfiguren könnten im Unterricht nach den Funktionen von Tieren in der Literatur und weitergehend in der Gesellschaft gefragt und so kulturelle Vorannahmen und Glaubenssätze kritisch beurteilt werden. Ziel soll dabei sein, auf anthropozentrische und speziesistische Perspektiven aufmerksam zu machen.
Diese im engeren Sinne den Human-Animal Studies zugehörigen Texte sind für die Tierbefreiungsbewegung vielleicht weniger unmittelbar relevant – es ist dennoch interessant und hocherfreulich zu sehen, welch weite universitäre Gegenden Tiere inzwischen bevölkern. Ein gelungener und empfehlenswerter Sammelband!
Fussnoten
[1] Um nur eine kurze Auswahl an wichtigen Erscheinungen des vergangenen Jahrzehnts im deutschen Sprachraum zu nennen: Bereits 2008 erschien von Jessica Ullrich u. a. als Herausgeberin der Sammelband Ich, das Tier. Tiere als Persönlichkeiten der Kulturgeschichte (Reimer). Die Kunsthistorikerin Ullrich publiziert seit 2012 auch die Zeitschrift Tierstudien (Neofelis), die erste Zeitschrift für Human-Animal Studies im deutschsprachigen Raum. 2011 folgte der einflussreiche Band Human-Animal Studies, herausgegeben von Chimaira – Arbeitskreis für Human-Animal Studies (transcript). Von Roland Borgarts u. a. erschienen als Herausgeber die folgenden Titel: Tier – Experiment – Literatur (Königshausen & Neumann 2013), Texte zur Tiertheorie (Reclam 2015) und Tiere. Kulturwissenschaftliches Handbuch (Metzler 2016). 2017 von Gabriela Kompatscher u. a. der sehr gut lesbare, einführende Band Human-Animal Studies (utb). Im anglophonen Raum, wo die Human-Animal Studies sich schon in den späten Achtzigerjahren des letzten Jahrhunderts zu etablieren begannen, ist die Flut der Publikationen bereits fast unüberschaubar.
[2] Regan hat dabei explizit Peter Singers Ansatz im Blick; wie gezeigt steht aber auch Dieter Birnbacher in der Tradition des Utilitarismus.
[3] Tatsächlich sind dies Überlegungen, die auch Peter Singer anstellt; er stellt sie konsequenterweise auch bezüglich den sogenannten «Grenzfällen» an, nämlich Babys und kognitiv schwer Behinderten – was Singer viel Kritik eingetragen hat und den Vorwurf kühler Rationalität wohl eher verstärkt. Singer sagt denn auch in seinem ersten Buch Animal Liberation (1975), dass er von Tieren nicht besonders berührt werde und er in seiner Argumentation bewusst auf Gefühle wie Tierliebe verzichten wolle.


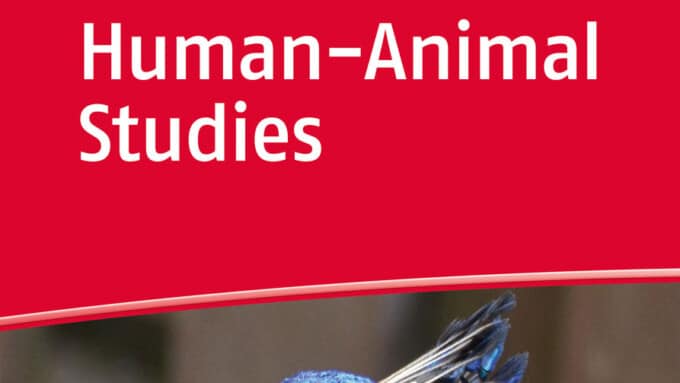

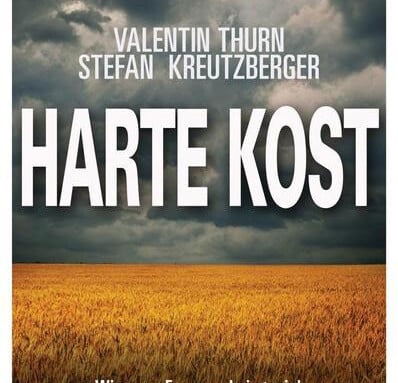
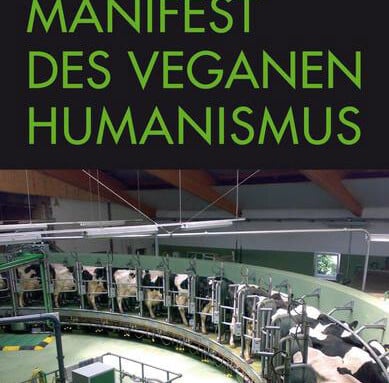


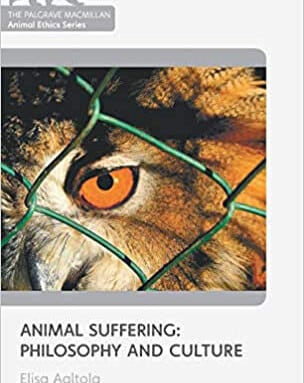
1 Kommentar
Interessanter Report. In der Sache hatten es selbst philosophisch wohlwollende Ansätze zum Tierischen Leben es schwer, sich von gewissen Grenzen zu entfernen, ersichtlich bei Schopenhauer und jüngst noch bri dem kürzlich verstorbenen Robert Spaemann.
Dann müssen zweifelsohne Gründe gefunden den werden, damit das Schnitzel dennoch schmeckt.
Zu Birnbacher die Begründung nicht tief genug.
Ich denke ausserdem, dass es mehr als ersichtlich ist, dass zumindest vielen Tieren ein Zukunftsbezug offen steht und sie auch über erinnernde Kapazitäten verfügen.
Dass Singer auf Gefühle gänzlich Nichten will ist ein grosser Fehler seines Ansatzes, Herr Precht wies darauf hin.
ZUR Bedeutung auch des Fühlen vgl Nussbaum.
Grundlage des Problem bei Singer-trotz Variation des Utility. Modells a la präferenz und quasi personalStatus Austauscharkeit von Lebewesen. Insofern halte ich auch den Speziesismusbegriff nicht für wirklich hilfreich reichend um zu begründen.
Es wird doch bri Singdr das einzelne Individuum überhaupt nicht erkannt.
Albert Schweitzer mir immer noch lieber.
Dass es vor der Aufklärung kein Mitempfinden zu Tieren gegeben habe , stimmt in dieser Einfachheit überhaupt nicht.
Wiewohl die alten Zeiten alles als wünschenswert waren, sei doch zumindest an Jesaja 65 Kohelet Hieronymus die Essener die Katharer erinnert.
Origines wohl auch.
Von den alten Denkern waren Porphyrios und Empedokles Vegetarier wahrscheinlich auch Pythagoras.
Im indischen Bereich wollen wir Mahavira gedenken.
In China Mengtse.
Und Leonardo da Vinci in ambpise an der Loire ass auch kein Tier
Das sollte immerhin bedacht werden
Die heutige Zeit hingegen mit 65 Milliarden Toten Tieren pro Jahr nur begrenzt weiter.
Früher wurde zudem viel weniger Fleisch gegessen als heutzutage.