Stinkende Schweine. Das Feilschen ums Wohl der Eber
Den KonsumentInnen stinkt's: Sie wollen kein Fleisch von Ebern. Also werden die kleinen Ferkel kastriert, geimpft oder züchterisch manipuliert. Das Wohl der Tiere bleibt dabei auf der Strecke – auch wenn von all denen, die ihr Geld an den Schweinen verdienen, laufend das Gegenteil behauptet wird. Ein Artikel der beiden tif-Autoren Klaus Petrus und Tobias Sennhauser.
Archiv
Dies ist ein Beitrag von unserer alten Website. Es ist möglich, dass Bilder und Texte nicht korrekt angezeigt werden.
Den KonsumentInnen stinkt’s: Sie wollen kein Fleisch von Ebern. Weil die Hoden der Schweine bei Geschlechtsreife Hormone entwickeln, die beim Erhitzen des Fleisches einen muffelnden Geruch hinterlassen, werden die Ferkel in den ersten zwei Wochen nach ihrer Geburt kastriert. In Deutschland sind das zwischen 23 und 25 Millionen Tiere pro Jahr, in der Schweiz 1.3 Millionen. Hier ist das betäubungslose Kastrieren seit dem 1. Januar 2010 per Gesetz verboten.
Damit scheint der Druck auf die Branche vorerst gewichen: Der üble Geruch ist vom Teller und dem Tierschutz Genüge getan. Gelöst sind die Probleme aber auch mit einer Kastration „unter Schmerzausschaltung“ noch lange nicht.
Ferkelglück dank Gas
Da wäre zum Beispiel die Frage der Betäubungsmethode. Einigermassen effizient sei eine komplette Narkose mit dem Gas Isofluran, meint das Bundesamt für Veterinärwesen BVET. Um die Schmerzen nach dem Aufwachen zu lindern, wird den Ferkeln zudem ein Schmerzmittel verabreicht, denn genäht wird die Operationswunde nach wie vor nicht.
Billig ist das Prozedere für die SchweineproduzentInnen allerdings nicht: Wer sich ein eigenes Narkosegerät anschaffen will, muss um die CHF 10.000.– investieren. Aber auch ohne ein solches Gerät belaufen sich die Kosten für das Narkosegas, das Schmerzmittel und den erhöhten Arbeitsaufwand auf rund 2 Franken pro Ferkel.
Hinzu kommen Vorbehalte von höchster Ebene: Schon geringfügige Änderungen des Gasgemisches können zu Schwankungen der Narkosetiefe führen, heisst es bei der schweizerischen Überwachungsbehörde für Arzneimittel Swissmedic. Ausserdem bestehe für die Ferkel die Gefahr einer Unterkühlung. Zu guter letzt habe Isofluran eine äusserst ungünstige Öko-Bilanz. Das Gas ist rund 500 mal klimaschädlicher als CO2, zum Vergleich: das gefürchtete Methan, das im Magen von Wiederkäuern produziert wird und die Kuh inzwischen als „Klimakiller Nr. 1“ in Verruf gebracht hat, ist etwa 20 mal schädlicher als CO2.
Oder doch lieber impfen?
Betäubung hin oder her, ein Eingriff ins Wohl der Tiere ist die Kastration ohnehin. Das sehen nicht bloss Tierschutzorganisationen so, sondern auch Grossverteiler wie Coop. Gemeinsam mit Fachleuten aus der Branche, Forschung und Behörde hat der Detaillist im Projekt ProSchwein während vier Jahren intensiv geforscht und eine Impfung gegen Ebergeruch entwickelt.
Das von Coop mitfinanzierte Verfahren ist simpel: Ein Impfstoff namens Improvac – er stammt vom US-Pharmakonzern Pfizer und wurde 2007 zugelassen – induziert Antikörper, welche die Entwicklung der Geschlechtshormone hemmen. Im Schnitt sind zwei Impfungen nötig, damit die Hoden der Schweine verkümmern und der Ebergeruch zuverlässig unterdrückt wird. Allerdings wirkt der Impfstoff nur kurze Zeit. Deshalb müssen die Schweine spätestens sechs Wochen nach der zweiten Impfung geschlachtet werden, denn danach sind nicht mehr genügend Antikörper vorhanden.
Noch 2008 hatte sich das BVET klar für die Impfung ausgesprochen. Inzwischen häufen sich die Anzeichen dafür, dass sich die „Immunokastration“ auch in der Schweiz nicht durchsetzen wird. Die Vorbehalte grosser Unternehmen, den KonsumentInnen geimpftes Fleisch vorzusetzen, sind offenbar zu gross – und das, obschon von offizieller Seite immer wieder beteuert wird, dass die im Impfstoff enthaltenen Eiweisse vollständig abgebaut würden und das Fleisch somit keine Rückstände enthalte.
Jungeber braucht das Land: irgendwann
Auch deswegen setzen fast alle Interessenverbände auf die Jungebermast – zumindest langfristig, wie es einschränkend heisst. Die Vorteile liegen auf der Hand: Werden die Ferkel nicht mehr kastriert, fallen Aufwand und Kosten für eine Betäubung weg, auch eine Impfung ist nicht mehr nötig. Zudem wachsen Eber schneller als kastrierte Schweine und können das Futter besser verwerten, was unterm Strich heisst: Sie haben eine höhere Mastleistung.
Das eigentliche Problem aber bleibt: Jeder Eber kann zum „Stinker“ werden, wie sie in der Branche heissen. Und eine zuverlässige Methode, geruchsauffällige Fleischpartien am Schlachtkörper zu erkennen, gibt es bis dahin nicht. Erwünscht wäre eine vollautomatische Erkennung geruchsbelasteter Tiere, wie sie das Institut für Landtechnik an der Universität Bonn zu entwickeln versucht. In der Schweiz ist diese „elektronische Spürnase“ aber bisher nicht im Einsatz, und es sei „eher unwahrscheinlich, dass jemand in diese Richtung investiert“, wie Denise Marty von KAGfreiland vermutet.
Bereits 1999 hat die Nutztierschutz-Organisation das Projekt „Eber statt Kastraten“ lanciert. Gegenwärtig gibt es sieben KAG-Mäster, zwei davon liefern das Fleisch an die Metzgerei Eichenberger im zürcherischen Wetzikon. Das Unternehmen wurde 2005 für seinen Eber-Bauernschüblig mit dem Prix d’innovation agricole ausgezeichnet, jetzt aber bleibt die Metzgerei auf ihrem Eberfleisch sitzen: „Sie hat Kunden, die kein Schweinefleisch kaufen, wenn sie wissen, dass es Eberfleisch ist, obwohl es nicht riecht“, sagt KAG-Ebermäster Sepp Sennhauser. „Ich hoffe, es kommt wieder Schwung in die CH-Ebermast.“
An den SchweineproduzentInnen liegt es nicht, sagt auch Denise Marty. Sie spricht von „Riesenvorurteilen“, die hierzulande vor allem MetzgerInnen und VerkäuferInnen gegen die Ebermast haben. Das sei in traditionellen Ebermastländern wie Grossbritannien, Irland oder Spanien und nun vermehrt auch in Deutschland und Holland ganz anders. Dort werden seit Jahren Eber im grossen Stil produziert und verarbeitet.
Keine verlässigen Zahlen über „Stinker“
Über die Zahl „geruchsbelasteter“ Eber herrscht im Übrigen keine Einigkeit. Nach Angaben von Tönnies, dem grössten Schlachtunternehmen Deutschlands, sind es 4 Prozent, der Schweizer Fleisch-Fachverband (SFF) redet von 5 Prozent, Demeter von 2 bis 10 Prozent und Denise Marty von KAGfreiland nennt 10 Prozent. Dagegen hat eine Studie des deutschen Instituts für Nutztiergenetik 60 Prozent der Eber als „Stinker“ identifiziert.
Für Peter Spring von der Schweizerischen Hochschule für Landwirtschaft (SHL) sind diese widersprüchlichen Angaben auf die Kochproben zurückzuführen, die bisher fast überall zum Einsatz kommen, aber den gefürchteten Ebergeruch nur „rudimentär und subjektiv“ ermitteln können.
Bei diesem aufwändigen Geruchstest werden Teilstücke aus dem Hals der geschlachteten Schweine einer Koch- und Bratprobe unterzogen und von Amtsveterinären auf ihre Genusstauglichkeit hin getestet. Belastete Fleischpartien werden entsorgt oder zu Würsten, Schüblig oder Schinkenspeck verarbeitet. Um eine „objektive Messmethode“ handle es sich dabei aber nicht, wie auch Denise Stadler, Mediensprecherin von Coop, sagt.
Aggressionen in der Schweinebucht
Der Grossverteiler Coop muss es wissen, denn auch er arbeitet im Programm Coop Naturafarm an der Ebermast. Die beiden Pilotprojekte, die Ende 2012 abgeschlossen werden, möchte das Unternehmen zwar noch nicht bekannt geben: „Wir sehen aber heute schon, dass es auf vielen Stufen sehr anspruchsvoll ist“, räumt Stadler ein.
So zeigen unkastrierte Schweine eine deutlich höhere Neigung zu aggressivem Verhalten, was vor allem am Ende der Mast Probleme macht: Das Aufreiten bezahlen die besprungenen Tiere häufig mit Gelenkschäden, die Rangkämpfe unter den Jungebern führen zu Verletzungen an Flanken und Schultern.
Mit der Haltung lässt sich anscheinend einiges richten: Beim Abferkeln sei unbedingt darauf zu achten, dass die Wurfgeschwister beisammen bleiben, denn das beruhigt, schreibt das Forschungsinstitut für Biologischen Landbau (FiBL) Austria. Günstig seien ausserdem saubere Liegeflächen, da Skatol – eine wichtige Komponente des Ebergeruchs – aus dem Kot in den Körper der Tiere gelangen kann. Auch an der Nahrung wird getüftelt. So hätten gewisse Aminosäuren nachweislich eine beruhigende Wirkung auf die Eber und eine hochdosierte Kost mit Chicorée-Wurzeln und Topinambur-Knollen könne den Skatolgehalt deutlich verringern.
Naheliegend wäre es, die Tiere nach Geschlecht getrennt zu mästen, denn so lässt sich die sexuelle Entwicklung der Jungeber zumindest hinauszögern. Aber auch diese Methode ist umstritten. „Seit einiger Zeit halte ich die Tiere nicht mehr getrennt und habe nur wenige Stinker“, sagt zum Beispiel KAG-Mäster Sepp Sennhauser. Allerdings müssten die Jungeber noch vor der ersten Brunst der weiblichen Tiere geschlachtet werden, also bereits mit 6 Monaten.
Die saubere Lösung: geruchsfreie Eber züchten
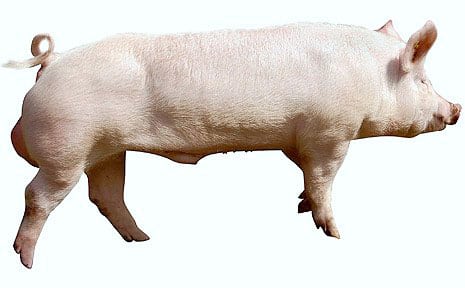
Für die Betriebe bedeutet das natürliche Sexualverhalten von Schweinen – man mag es drehen und wenden, wie man will – zusätzlichen Aufwand. Erst wenn er beseitigt werden kann, wird sich die Ebermast etablieren können und die Kastration der Vergangenheit angehören, sind ExpertInnen überzeugt. Doch die Zeit drängt. Unlängst haben sich Branchenverbände aus der Landwirtschaft für eine Abschaffung der Ferkelkastration im gesamten EU-Raum bis 2018 ausgesprochen.
Und so wird derzeit europaweit in zwölf Grossprojekten emsig nach der ultimativen Lösung geforscht. Mit dabei ist auch SUISAG, das schweizerische Dienstleistungszentrum für Schweineproduktion mit Sitz in Sempach. Gemeinsam mit der VetSuisse Fakultät Zürich, der Schweizerischen Hochschule für Landwirtschaft (SHL), der Forschungsanstalt Agrosope Posieux (ALP) sowie etlichen Industriepartnern ist SUISAG seit 2010 auf der Suche nach einer Zuchtmethode gegen Ebergeruch.
„Es ist schon lange bekannt, dass Ebergeruch eine mittlere bis hohe Erblichkeit aufweist“, sagt Henning Luther, Zuchtleiter bei SUISAG. Hier setzt das mit CHF 600.000.– dotierte und vom Bund zur Hälfte finanzierte Projekt an. Es geht darum, den Ebergeruch an lebenden Zuchttieren zuverlässig messen zu können, um „mit Hilfe dieser Daten die Grundlagen für eine zukünftige Zucht gegen Ebergeruch zu entwickeln“.
Geprobt wird an künstlich besamten Jungebern, die SUISAG 2009 mit dem Markennamen Premo® patentieren liess. Sie zeichnen sich nicht nur dadurch aus, dass ihre Nachkommen rasch an Gewicht zunehmen und das übliche Schlachtgewicht somit früher erreichen als die übrigen Schweine. Premo®-KB-Eber haben offenbar auch eine geringere Veranlagung zum Ebergeruch, wie die Zuchtfirma mitteilt.
Wie erfolgsversprechend das Projekt sein wird, ist noch unklar. Ein mögliches Risiko sieht Andreas Hofer, Leiter des Geschäftsbereichs Zucht bei SUISAG, in negativen Auswirkungen auf die Fortpflanzungsfähigkeit weiblicher Tiere. Definitive Resultate werden aber erst Ende 2012 erwartet. Für Projektpartner Peter Spring von der SHL steht bereits jetzt fest: „Funktioniert die Zucht gegen Ebergeruch und sinkt dadurch das Geruchsrisiko und der Prozentsatz der Tiere, die aussortiert werden müssen, geht die Entwicklung in Richtung Ebermast.“
„In erster Linie geht es um das Wohl der Tiere“
Für die meisten der an der Eber-Debatte beteiligten Interessengruppen scheint klar: Die Vorurteile nicht bloss der KonsumentInnen, sondern insbesondere auch der Metzgereien gegenüber Eberfleisch sind nur schwer zu überwinden – jedenfalls solange ihm der üble Geruch nachgesagt wird. Schon deshalb sei eine züchterische Ausmerzung des Sexualtriebes die sauberste Lösung.
Was offenbar auch den Schweinen zu Gute kommt: „Bei der ganzen Thematik geht es in erster Linie um das Wohl der Tiere“, stellte Hans Wyss, Direktor des Bundesamts für Veterinärwesen BVET, bereits 2008 fest. Sind in Zukunft signifikant weniger geruchsauffällige Masteber auf dem Markt, ist das Thema Kastration endgültig vom Tisch, es braucht keine Impfungen und gibt auch kein Gerangel im Schweinestall mehr.
Heisst das nun, dass ein züchterischer Eingriff ins Sexualleben das Wohlergehen der Schweine gar nicht berührt? Keineswegs. Das Wohl und Wehe eines Lebewesens hängt nicht allein davon ab, ob es Schmerzen erleidet, es erstreckt sich vielmehr auf sämtliche Facetten seines Daseins: so auch auf sein Nahrungsverhalten, sein Sozialleben, sein Bewegungsverhalten, seine Gesundheit, auf ein möglichst langes, artgerechtes Leben und – als Voraussetzung all dessen – auf sein natürliches Sexual- und Fortpflanzungsverhalten. In all diesen Bereichen kann das Wohlergehen von Tieren geschützt oder auch beeinträchtigt werden.
Das Übel bei der Wurzel packen: Aufklärung tut Not!
Das sieht im Übrigen nicht bloss die Verhaltensforschung so, sondern auch der Gesetzgeber. Und verbietet in den Grundsätzen des Tierschutzgesetzes Art. 4 Abs. 2 jede Art der „ungerechtfertigten“ Beeinträchtigung tierlichen Wohlergehens. Um das Wohl von Tieren zu beeinträchtigen, braucht es mit anderen Worten einen wirklich guten Grund. Im Falle der Eber – ob sie nun kastriert, geimpft und züchterisch manipuliert werden – bestünde diese Rechtfertigung wohl im Nachweis, es sei für uns KonsumentInnen notwendig, Schweinefleisch zu konsumieren.
Aber dieser Nachweis wird nur schwer zu erbringen sein. Niemand dürfte ernsthaft bestreiten, dass der Fleischkonsum in einem Wohlstandsland wie der Schweiz, wo ein Grossteil der Bevölkerung nicht an Mangelerscheinungen leidet, weitgehend überflüssig ist. Die Frage ist vielmehr: Will man – ja, sollte man – endlich und möglichst vorbehaltslos über die Vorteile und Risiken einer Ernährung ohne tierliche Produkte informieren?
Dass diese Frage nicht zwingend auf der Agenda jener steht, die eifrig an einer Lösung des Eber-Problems forschen, liegt auf der Hand. Immerhin verdienen sie alle – von SUISAG über Coop bis hin zu den KAG-Mästern – mit den Schweinen ihr Geld.
Der Einwand, man müsse sich auf das derzeit Machbare beschränken, ist nachvollziehbar, er übersieht aber das Offensichtliche: Eine vorwiegend oder gar ausschliesslich pflanzliche Ernährung ist hierzulande längst keine Utopie mehr, sondern durchaus praktikabel.
Die Hürden liegen anderswo: Bei einem fehlenden oder gar fehl geleiteten Ernährungswissen, bei der mangelnden Verfügbarkeit veganer Lebensmittel, bei einer demokratiepolitisch bedenklichen Verfügungsmacht der Tierindustrie über die Bewerbung ihrer Produkte, bei der fragwürdigen Subventionspolitik des Bundes. Und bei einer bemerkenswert eingeschränkten Sicht auf das viel zitierte Tierwohl – eine Sicht, die Kastrationen zwar verurteilt, züchterische Eingriffe in fundamentale Bedürfnisse der Tiere aber wie selbstverständlich als ein notwendiges Übel erachtet.









Noch keine Kommentare